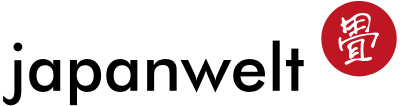Yakudoshi – Unglücksjahre in Japan: Bedeutung, Zahlen und Rituale
In Japan gibt es Jahre, die als besonders schwer gelten. Sie heißen Yakudoshi (厄年) – die Unglücksjahre. In diesen Lebensabschnitten glaubt man, dass Unglück, Krankheit oder Krisen häufiger auftreten. Doch was bedeutet Yakudoshi genau, welche Lebensjahre betrifft das? Yakudoshi ist Teil einer größeren Tradition, in der Lebenszyklen und Zahlen eine besondere Rolle spielen.
Die Unglücksjahre Yakudoshi sind in Japan kein bloßer Aberglaube, sondern kulturelle Marker für Übergänge im Leben. Sie machen Phasen sichtbar, in denen Menschen besonders verletzlich erscheinen, und bieten zugleich Rituale, um das eigene Leben bewusster zu gestalten. Ob durch Schreine, Feuerzeremonien oder Dorffeste – Yakudoshi zeigt, wie tief Tradition, Spiritualität und Gemeinschaft in Japan miteinander verwoben sind.

- Eine Yakudoshi-Tabelle (厄年表) an einem japanischen Tempel. Sie zeigt die Unglücksjahre für Männer und Frauen nach Alter und Geburtsjahr – in Rot sind die Kernjahre markiert, für die spezielle Rituale empfohlen werden. Foto © hiroooooki - 厄歳表, CC BY 2.0
Männer im Yakudoshi: 25, 42 und 61 Jahre
Für Männer gelten traditionell drei Lebensalter als kritisch. Das 25. Jahr steht für den Eintritt ins Erwachsenenleben, in dem man Verantwortung trägt, aber noch nicht gefestigt ist. Viele junge Japaner berichten, dass sie in diesem Alter häufig zum ersten Mal in Großstädte ziehen, den Job wechseln oder Heirat und Familiengründung anstehen – ein Übergang voller Chancen, aber auch voller Unsicherheit.
Das 42. Jahr ist besonders gefürchtet: In japanischer Lesart klingt die Zahl wie shi-ni – „sterben“. Kein Wunder, dass Tempel und Schreine in diesem Jahr stark besucht werden. So gilt zum Beispiel der Kawasaki Daishi Tempel nahe Tokio als einer der beliebtesten Orte, um sich durch Yakuyoke-Rituale von diesem Unglücksjahr zu reinigen. Viele Männer reisen eigens dorthin, um eine Zeremonie abzuhalten und ein schützendes Omamori-Amulett zu erwerben.
Das 61. Jahr wiederum ist ambivalent. Manche betrachten es als gefährliches Unglücksjahr, andere feiern es als Kanreki, den Neubeginn des 60-Jahres-Zyklus. Familien veranstalten zu diesem Anlass oft ein Fest, bei dem die Person in roter Kleidung erscheint – Rot symbolisiert Schutz und Wiedergeburt. In manchen Regionen wird sogar ein ganzes Bankett organisiert, um den Eintritt in den neuen Lebenszyklus würdevoll zu begehen.
Wer mehr über diese 12 Tierkreiszeichen erfahren möchte, findet hier eine ausführliche Übersicht: Japanische Tierkreiszeichen – Jūnishi
Frauen im Yakudoshi: 19, 33 und 37 Jahre
Frauen erleben ihre Unglücksjahre etwas früher. Das 19. Jahr markiert den Schritt ins Erwachsenenalter, in dem viele junge Frauen in Japan das Elternhaus verlassen, ins Berufsleben eintreten oder mit dem Studium beginnen. Gerade in dieser Lebensphase berichten viele von Unsicherheit und Orientierungssuche – ein Grund, warum dieses Jahr traditionell als kritisch gilt.
Das 33. Jahr gilt wegen der lautlichen Nähe zu sanzan („mühsam, katastrophal“) als besonders belastet. Viele Schreine veranstalten spezielle Yakuyoke-Zeremonien nur für Frauen in diesem Alter. Am berühmten Kiyomizu-dera in Kyoto werden zum Beispiel jedes Jahr Gebete abgehalten, die ausdrücklich auf das „Frauen-Unglücksjahr“ (onna-no-yakudoshi) ausgerichtet sind. Nicht selten besuchen Frauen gemeinsam mit Freundinnen oder Familienmitgliedern diese Zeremonien, um Unterstützung und Schutz zu erbitten.
Auch das 37. Jahr wird vielerorts gefürchtet. Häufig fällt es in eine Lebensphase, in der Beruf und Familie parallel viel Energie fordern. In manchen Regionen ist es üblich, dass Frauen in diesem Jahr ein spezielles Omamori-Amulett für Gesundheit und Familienglück tragen. Manche Tempel, etwa in der Kansai-Region, bieten sogar eigene „Frauen-Yakuyoke-Tage“ an, bei denen Gebete und Reinigungen gezielt auf das 33. und 37. Jahr abgestimmt sind.
Hinzu kommen jeweils das Jahr davor (Maeyaku) und danach (Atoyaku), sodass sich ein Dreijahresbogen ergibt, der besonders aufmerksam begangen wird – oft begleitet von wiederholten Schreinbesuchen oder kleinen Familienritualen, die das drohende Unglück symbolisch abwenden sollen.

- Ein traditionelles Omamori-Amulett aus einem japanischen Schrein. Es soll während der Yakudoshi getragen, um Schutz und Glück zu erbitten. Foto © Suki Lee
Kazoe-doshi – die Zählweise der Unglücksjahre
Verwirrend ist, dass die Yakudoshi oft nach der traditionellen Zählweise kazoe-doshi berechnet werden. Dabei gilt ein Kind bei der Geburt schon als ein Jahr alt, und mit jedem Neujahr kommt ein weiteres Jahr hinzu.
Das bedeutet: Ihr tatsächliches Unglücksjahr kann nach westlicher Zählweise ein Jahr früher eintreten, als Sie es erwarten. Wer also glaubt, erst 41 zu sein, gilt in Japan bereits als 42 – mitten im gefährlichsten Yakudoshi.
Einen tieferen Einblick in die japanische Kultur von Glück und Unglück im Alltag finden Sie in unserem Beitrag Fuku & Batsu – Glück und Pech im Alltag.
Warum gerade diese Jahre?
Die Erklärung für die Yakudoshi-Zahlen verbindet zwei Dimensionen. Zum einen gibt es sprachliche Assoziationen: 42 klingt wie „sterben“, 33 wie „mühsam“, 19 wie „großes Leid“. Zum anderen spiegeln diese Altersjahre markante Lebensphasen wider – vom Eintritt ins Erwachsenenleben über die Midlife-Krise bis hin zum Neubeginn mit 61 Jahren.
Regionale Unterschiede und Wandel
Interessant ist, dass die Auswahl der Jahre nicht überall in Japan identisch ist. In manchen Regionen gelten zusätzlich auch andere Lebensalter als kritisch, etwa das 49. Jahr bei Männern oder das 37. Jahr bei Frauen in stärkerem Maße.
Alte buddhistische Texte nennen sogar eine ganze Reihe von problematischen Jahren wie 13, 25, 37, 49 oder 61, die in Verbindung mit Übergängen im Lebenszyklus gebracht werden. Das zeigt, dass die Liste der „Unglücksjahre“ nicht starr, sondern historisch wandelbar ist.
Mehr über die faszinierende Welt der japanischen Zahlensymbolik und ihre Bedeutung im Buddhismus erfahren Sie in unserem Artikel Japanische Zahlen und ihre Symbolik.
Verbindung zu Gesundheit und Lebensphasen
Ein weiterer Aspekt betrifft die Verbindung zu medizinischen Vorstellungen. Historiker verweisen darauf, dass Yakudoshi-Jahre häufig mit Phasen zusammenfallen, in denen Menschen gesundheitlich anfälliger sind – sei es durch körperliche Reifung im Teenageralter, durch Belastung in der Mitte des Lebens oder durch altersbedingte Schwächen.
So entsteht ein Brückenschlag zwischen Aberglaube und Erfahrungswissen: Die Jahre erscheinen gefährlich, weil sie in der Realität oft mit Umbrüchen oder Krisen verbunden sind.
Soziale Erwartungen und Druck
Schließlich spielen auch sozial-kulturelle Erwartungen eine Rolle. Wer mit 33 oder 42 Jahren noch nicht geheiratet hatte, stand früher unter gesellschaftlichem Druck. Yakudoshi wurde so zu einem kulturellen Spiegel: Es markierte nicht nur biologische, sondern auch soziale Übergänge – und verlieh ihnen durch die Zuschreibung von Gefahr eine noch stärkere Bedeutung.
Historische Wurzeln der japanischen Unglücksjahre: Von Onmyōdō zum Shintō
Die Idee der Unglücksjahre stammt ursprünglich aus dem Onmyōdō, einer Mischung aus chinesischer Astrologie, Yin-Yang-Lehre und Himmelsrichtungen. In der Heian-Zeit beeinflusste diese Kosmologie Hof und Tempel.
Heute aber ist Yakudoshi fest im Volksglauben verankert und eng mit dem Shintō und dem Zen-Buddhismus verbunden. Schreine und Tempel bieten spezielle Yakuyoke- und Yakubarai-Rituale an, um Unheil abzuwenden und Schutz zu erbitten.
Rituale zur Unglücksabwehr: Yakuyoke und Yakubarai
In einem Yakudoshi-Jahr suchen viele Menschen religiöse Unterstützung. An Schreinen werden Reinigungszeremonien (Harae) durchgeführt und Omamori-Amulette verkauft. In buddhistischen Tempeln gibt es oft große Goma-Feuerzeremonien, bei denen Sorgen und Unglück symbolisch verbrannt werden.
Besonders bekannt ist der Tempel Kawasaki Daishi nahe Tokio. Dort finden täglich Yakuyoke-Rituale statt, die viele Besucher als Mischung aus Ehrfurcht und Erleichterung beschreiben. Manche Männer greifen im 42. Jahr auch zu einer sehr alltäglichen Schutzmaßnahme: Sie tragen rote Unterwäsche – Rot gilt als Farbe der Abwehrkraft.

- Ein buddhistischer Mönch führt eine Goma-Feuerzeremonie im Shingon-Tempel in Nara durch - eines der wichtigsten Rituale zur Reinigung und zum Schutz vor den den Yakudoshi. Foto © Japanexperterna, CC BY-SA 3.0
Yakudoshi in der Gemeinschaft: Das Feuerfest in Nozawa Onsen
Wie stark Yakudoshi mit sozialem Leben verwoben ist, zeigt das Dosojin-Feuerfestival in Nozawa Onsen (Nagano). Männer im 25. und 42. Jahr übernehmen dort die Hauptrolle. Gemeinsam errichten sie eine mehrstöckige Holzkonstruktion. Die Jüngeren verteidigen sie mit Seilen und Stangen, die Älteren versuchen, sie zu entflammen. Am Ende geht das Bauwerk in einem riesigen Feuer auf.
Ein Teilnehmer beschreibt sein Yakudoshi-Ritual als „Initiationsritus, schmerzhaft und fordernd, aber voller Stolz und Verbundenheit“. Hier wird das Unglücksjahr zu einem Ereignis, das nicht Angst schürt, sondern Gemeinschaft und Identität stiftet.
Wenig bekannte Aspekte von Yakudoshi
Im Westen wird Yakudoshi oft nur als Aberglaube erklärt. Doch es gibt zusätzliche Dimensionen, die selten erwähnt werden. So bedeutete „yaku“ in alten Texten nicht nur „Unglück (厄)“, sondern auch „Amt, Rolle (役)“. In Dörfern war es üblich, dass Menschen im Unglücksjahr religiöse Pflichten übernahmen.
Außerdem gibt es Rituale zur Richtungsabwehr (Hōiyoke): Ungünstige Himmelsrichtungen sollen durch Zeremonien neutralisiert werden. Manche Tempel kombinieren Yakudoshi zudem mit der Kyūsei-Neun-Sterne-Astrologie, die persönliche Jahresenergien berechnet.
Diese synkretische Verbindung von Shintō, Buddhismus und Onmyōdō ist in Japan Alltag, in westlichen Texten aber kaum präsent.
Häufige Fragen zu Yakudoshi
Was ist Yakudoshi?
Yakudoshi bezeichnet die Unglücksjahre in Japan, bestimmte Altersstufen, die als besonders risikoreich gelten.
Welche Jahre gelten als Unglücksjahre?
Für Männer sind es 25, 42, 61, für Frauen 19, 33, 37. Dazu gehören Vor- (Maeyaku) und Nachjahre (Atoyaku).
Welche Rituale gibt es?
Typisch sind Yakuyoke (Abwehr) und Yakubarai (Reinigung), aber auch Omamori-Amulette und Feuerzeremonien.
Ist Yakudoshi wissenschaftlich belegt?
Nein, es handelt sich um Volksglauben. Dennoch sind die Rituale tief in Kultur und Festen wie dem Dosojin-Feuerfest verankert.
Das könnte Sie auch interessieren:
Shichi Fukujin – die sieben Glücksgötter Japans
Welche Bedeutung haben Tiere in Japan? Mythologie und Symbolik
Christen in Japan: Von Missionaren, Märtyrern und modernen Gläubigen
Die Bedeutung der Farben in Japan
Titelfoto © Joshua Eghelshi
Passende Artikel

MEISAN Daruma 9 cm
Diese Daruma stammen aus der Region Takasaki in der Präfektur Gunma. Diese Region ist traditionell bekannt für seine vielen Meisterbetriebe und Manufakturen, die sich der Herstellung echter japanischer Daruma verschrieben haben. MEISAN (jap. für "Spezialität, berühmtes Produkt") Daruma sind daher unsere besonderen Glücksbringer direkt aus der Manufaktur. Alle Daruma sind mit Liebe und Tradition hergestellt und...
12,00 € *
Inhalt: 1

Glücksbringer 'Winkekatze'
Glücksbringer Winkekatze in verschiedenen Farben mit einer Größe von etwa 3 cm. Farbwünsche können bedingt berücksichtigt werden. Japanische Glücksbringer, auch Engimono genannt, sind tief in der japanischen Kultur verwurzelt. Diese „Charaktere“ haben sich aus Legenden und Erzählungen aber auch aus den beiden Religionen Buddhismus und Shintoismus herausgebildet. Neben den chinesischen Tierkreiszeichen, die sich in der Regel jedes Jahr im...
9,00 € *
Kommentar schreiben