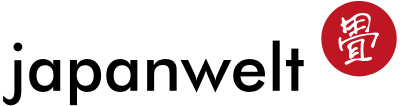Christen in Japan: Von Missionaren, Märtyrern und modernen Gläubigen
Das Christentum nimmt in Japan eine besondere Stellung ein. Obwohl es im Vergleich zu den traditionellen Religionen des Landes – Shintoismus und Buddhismus – nur eine kleine Minderheit darstellt, blickt es auf eine lange und bewegte Geschichte zurück. Diese ist geprägt von frühen Missionierungsversuchen, Zeiten intensiver Christenverfolgung sowie einer Phase des Wiederauflebens in der Moderne.
Heute leben schätzungsweise über eine Million Christen in Japan. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung ist zwar gering, doch sie bilden eine beständige, engagierte und auch einflussreiche Glaubensgemeinschaft.
Die Geschichte dieser Glaubensrichtung in Japan ist ebenso faszinierend wie komplex – sie erzählt von religiösem Eifer, politischer Ablehnung und dem Überleben einer kleinen, aber standhaften Gemeinschaft.
In diesem Beitrag erhalten Sie einen umfassenden Überblick über das Christentum in Japan: von seinen Anfängen im 16. Jahrhundert über die Zeit der Verbote und Verfolgungen bis hin zur Situation der Christen in der Gegenwart. Dabei betrachten wir sowohl die historischen Entwicklungen als auch die aktuellen Zahlen und Fakten.

-
Gemälde der Märtyrer von Nagasaki, die im 16. Jahrhundert auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden.
Foto © Schule von Cuzco - originally posted to Flickr as Painting of the Nagasaki Martyrs, Gemeinfrei
Japan und das Christentum: Ein kurzer Überblick
Das religiöse Leben in Japan ist seit Jahrhunderten vor allem durch den Shintoismus und den Zen-Buddhismus geprägt. Diese beiden Glaubensrichtungen sind tief im Alltag und in den Traditionen der japanischen Gesellschaft verwurzelt. Feste, Zeremonien und Bräuche spiegeln diese religiöse Vielfalt wider, wobei häufig eine synkretistische Praxis zu beobachten ist: Viele Japaner befolgen sowohl buddhistische als auch shintoistische Rituale, ohne einen exklusiven religiösen Anspruch zu erheben.
Das japanische Christentum hingegen nimmt in dieser religiösen Landschaft eine besondere Stellung ein. Es wurde im 16. Jahrhundert durch europäische Missionare – allen voran Franz Xaver – nach Japan gebracht.
Die neue Religion fand zunächst Anklang bei verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, einschließlich regionaler Herrscher. Doch bereits im frühen 17. Jahrhundert wurde das Christentum aufgrund politischer und sozialer Spannungen verboten. Eine systematische Christenverfolgung begann.
Trotz dieser historischen Brüche hat das Christentum in Japan bis in die Gegenwart überdauert. Heute gibt es in Japan schätzungsweise über eine Million Christen, rund ein Prozent der Gesamtbevölkerung. Sie gehören verschiedenen Konfessionen an, darunter die römisch-katholische Kirche, verschiedene protestantische Kirchen sowie orthodoxe Gemeinden.
In der modernen japanischen Gesellschaft spielt das Christentum eine eher symbolische Rolle. Die Glaubensgemeinschaft ist zwar zahlenmäßig klein, beeinflusst jedoch Bereiche wie Bildung und Sozialwesen – insbesondere durch christliche Schulen, Universitäten und Krankenhäuser. Darüber hinaus werden christliche Bräuche, wie zum Beispiel Hochzeiten in Kirchen, in den letzten Jahrzehnten immer populärer, orientieren sich meist an gesellschaftlichen Trends und weniger am religiösen Glauben.
Die Anfänge: Portugal bringt das Christentum nach Japan (ab 1549)
Die Geschichte des Christentums in Japan beginnt im Jahr 1549 – ein Wendepunkt, der die religiöse Landschaft des Landes nachhaltig beeinflussen sollte. Mit der Ankunft der portugiesischen Seefahrer und Missionare gelangten nicht nur neue Handelswaren nach Japan, sondern auch die Lehren des Christentums.
Der wohl bekannteste unter den ersten Missionaren war Franz Xaver, ein Mitbegründer des Jesuitenordens. Gemeinsam mit seinen Gefährten reiste er als Teil einer portugiesischen Mission nach Japan, mit dem Ziel, das Christentum zu verbreiten. Im August 1549 landete Franz Xaver in Kagoshima auf der Insel Kyūshū – der Beginn einer intensiven Phase missionarischer Tätigkeit.
Franz Xaver und die Jesuiten: Die ersten Missionare
Franz Xaver begegnete der japanischen Gesellschaft mit Respekt und Interesse. Er erkannte schnell, dass die Vermittlung des Christentums an die kulturellen und intellektuellen Gepflogenheiten der Japaner angepasst werden musste. Die Jesuiten lernten die japanische Sprache, übersetzten religiöse Texte und suchten den Dialog mit den lokalen Eliten. Besonders unter den Fürsten (Daimyō) in Kyūshū fanden sie erste Unterstützer, die sich – teils aus Glaubensüberzeugung, teils aus politischen oder wirtschaftlichen Motiven – taufen ließen.
Das Christentum in Japan um 1600: Eine wachsende Bewegung
Die Zahl der Christen stieg innerhalb weniger Jahrzehnte rasant an. Um das Jahr 1600 gab es Schätzungen zufolge etwa 300.000 bis 500.000 Christen in Japan. Zahlreiche Kirchen wurden errichtet, christliche Gemeinden etablierten sich in verschiedenen Regionen, und es entwickelte sich ein lebendiges Gemeindeleben.
Die Jesuiten, unterstützt von den Portugiesen, organisierten Schulen, Hospitäler und soziale Einrichtungen. Viele japanische Konvertiten sahen im Christentum eine Alternative zu den bestehenden religiösen Systemen, insbesondere wegen des Versprechens auf ein ewiges Leben im Paradies und der Ethik der Nächstenliebe.
Wie die Lehren Jesu in Japan aufgenommen wurden
Die Aufnahme des Christentums war jedoch ambivalent. Während einige Fürsten die neue Religion akzeptierten und sogar förderten, blieben viele skeptisch. Das Konzept eines einzigen, allmächtigen Gottes widersprach dem polytheistischen und synkretistischen Denken der traditionellen japanischen Religionen.
Auch die exklusiven Wahrheitsansprüche des Christentums stießen in einer Gesellschaft, die religiöse Toleranz und pragmatische Koexistenz gewohnt war, auf Unverständnis.
Gleichzeitig sorgte die enge Verbindung zwischen den Missionaren und den portugiesischen Händlern für Misstrauen. Es entstand der Verdacht, dass die Missionierung nicht nur religiösen Zielen diente, sondern auch als Vorstufe einer politischen Einflussnahme durch europäische Mächte verstanden werden konnte.
Diese widersprüchlichen Reaktionen legten bereits den Grundstein für die späteren Konflikte und die drastischen Maßnahmen, die das Tokugawa-Shogunat gegen die Christen ergreifen sollte.
Warum wurde das Christentum in Japan verboten?
Die Anfangszeit des Christentums in Japan war von raschem Wachstum geprägt. Doch mit der zunehmenden Verbreitung des neuen Glaubens mehrten sich auch die Bedenken in der politischen Führung. Besonders das Tokugawa-Shogunat betrachtete das Christentum als Bedrohung für die soziale Ordnung und die politische Stabilität des Landes.
Politische und gesellschaftliche Gründe für das Verbot
Nach der Einigung Japans unter Tokugawa Ieyasu (1603) war das vorrangige Ziel der neuen Herrscher, die Macht des Shogunats zu sichern und eine stabile Gesellschaftsordnung zu etablieren. Das Christentum galt aus mehreren Gründen als problematisch:
- Exklusiver Wahrheitsanspruch: Der christliche Glaube forderte von seinen Anhängern eine Abkehr von allen anderen Religionen und Glaubenspraktiken. In einer Gesellschaft, die bisher von religiöser Toleranz und synkretistischen Traditionen geprägt war, stellte dies ein neues und störendes Element dar.
- Loyalitätskonflikte: Christliche Missionare lehrten, dass Gott über alle weltlichen Herrscher stehe. Dies weckte die Sorge, dass Christen im Zweifel eher dem Papst oder europäischen Mächten als dem Shogun treu ergeben wären.
- Einfluss fremder Mächte: Die enge Verbindung zwischen Missionaren und portugiesischen Händlern verstärkte das Misstrauen. Es gab die Befürchtung, dass die Christianisierung Japans eine Vorbereitung auf eine koloniale Eroberung durch europäische Staaten sein könnte – ein Schicksal, das andere asiatische Regionen bereits ereilt hatte.
Beginn der Christenverfolgung in Japan
Bereits 1587 ließ Toyotomi Hideyoshi die Jesuiten aus Japan ausweisen, allerdings wurde das Edikt zunächst nur halbherzig umgesetzt. Nach der Machtergreifung des Tokugawa-Shogunats wurde das Vorgehen gegen Christen jedoch konsequenter.
Im Jahr 1614 erließ Tokugawa Ieyasu ein landesweites Verbot des Christentums. Alle Missionare wurden ausgewiesen, Kirchen zerstört und Gläubige gezwungen, ihrem Glauben abzuschwören.
Das Shogunat führte regelmäßige Überprüfungen durch, sogenannte Fumi-e-Zeremonien: Dabei mussten Menschen auf Bilder von Jesus Christus oder der Jungfrau Maria treten, um ihre Loyalität zum Staat zu beweisen.
Warum wurde das Christentum so hart verfolgt?
Das Verbot und die Verfolgung des Christentums waren Teil einer größeren Politik der Abschottung und Isolation Japans, bekannt als Sakoku. Durch diese Abschottungspolitik wollte das Shogunat jeden äußeren Einfluss minimieren, der die bestehende gesellschaftliche und politische Ordnung gefährden konnte.
Christen galten in dieser Logik als potenzielle Rebellen. Ihre Loyalität zu einer fremden Religion und mögliche Verbindungen zu ausländischen Mächten machten sie aus Sicht der Regierung zu einer Bedrohung, die es zu beseitigen galt.
Das Ende der offenen christlichen Praxis in Japan
Mit der systematischen Verfolgung wurden viele Christen gezwungen, ihrem Glauben abzuschwören oder diesen im Geheimen weiter zu praktizieren. Wer sich weigerte, musste mit Folter oder Hinrichtung rechnen. Die grausamen Strafen sollten nicht nur die Gläubigen brechen, sondern auch ein abschreckendes Beispiel für die gesamte Bevölkerung sein.
Dieses rigorose Vorgehen führte schließlich zur fast vollständigen Auslöschung des sichtbaren Christentums in Japan. Doch im Verborgenen überlebten einige Gemeinschaften, die sogenannten Kakure Kirishitan – „verborgene Christen“.
Die dunkle Zeit: Christenverfolgung und der Aufstand von Shimabara (1637-1638)
Mit dem Verbot des Christentums im Jahr 1614 begann eine der dunkelsten Phasen in der Geschichte der japanischen Christen. Was folgte, war eine systematische, brutal durchgeführte Christenverfolgung, die weite Teile der christlichen Bevölkerung in Angst, Verzweiflung und den Untergrund trieb. Die Jahre nach dem Verbot waren geprägt von harter Repression, Folter und öffentlichen Hinrichtungen.
Was hat Japan den Christen angetan? Die grausamen Verfolgungen
Die Behörden des Tokugawa-Shogunats gingen mit äußerster Härte gegen bekennende Christen vor. Wer sich weigerte, dem Christentum abzuschwören, wurde öffentlich bestraft. Die Methoden waren gezielt abschreckend: Kreuzigungen, Verbrennungen bei lebendigem Leib und das sogenannte Anazuri – eine qualvolle Form der Folter, bei der Opfer kopfüber in eine Grube gehängt wurden, bis sie starben oder ihren Glauben widerriefen.
Eines der bekanntesten Symbole dieser Zeit sind die Fumi-e-Prüfungen: Gläubige sollten auf Bilder von Jesus Christus oder der Jungfrau Maria treten, um zu beweisen, dass sie ihrem Glauben abgeschworen hatten. Wer sich weigerte, musste mit schweren Strafen rechnen. Diese Prüfungen wurden regelmäßig durchgeführt, um versteckte Christen zu entlarven.
Der Besitz christlicher Symbole, Bibeln oder Reliquien war strengstens untersagt. Gemeinden, die weiterhin heimlich Gottesdienste abhielten, liefen Gefahr, komplett ausgelöscht zu werden. Diese radikale Verfolgung führte dazu, dass viele Christen entweder hingerichtet wurden oder ihren Glauben in äußerster Geheimhaltung weiterlebten – es entstanden die sogenannten Kakure Kirishitan, die „verborgenen Christen“.

-
Eine Maria-Kannon als geheime Marienstatue in der Nantoyōsō-Sammlung, Japan.
Foto © Iwanafish gemeinfrei
Der Shimabara-Aufstand: Der letzte Widerstand der japanischen Christen
Die zunehmende Unterdrückung, verbunden mit hohen Steuerlasten und Hungersnöten, führte schließlich zum Shimabara-Aufstand in den Jahren 1637 bis 1638. Dieser Aufstand war nicht ausschließlich religiös motiviert, hatte aber eine starke christliche Komponente.
Die Bauern und Samurai der Region Shimabara sowie der benachbarten Amakusa-Inseln erhoben sich gegen die lokalen Herrscher und das Shogunat. Viele der Aufständischen waren Christen oder standen den verborgenen Gemeinden nahe. Ihr Anführer, Amakusa Shirō, war ein charismatischer junger Christ, der als „Messias“ verehrt wurde und seine Gefolgsleute in den Kampf führte.
Die Rebellen verschanzten sich in der Hara-Burg, wo sie sich mehrere Monate lang gegen die überlegenen Truppen des Shogunats verteidigten. Doch im Frühjahr 1638 wurde die Burg nach einer verlustreichen Belagerung gestürmt. Schätzungen zufolge wurden bis zu 37.000 Menschen getötet – Männer, Frauen und Kinder, Christen und Nichtchristen gleichermaßen.
Die Folgen des Aufstands
Der Shimabara-Aufstand markierte den endgültigen Bruch zwischen Japan und dem Christentum. Die brutale Niederschlagung des Aufstands führte dazu, dass das Christentum im öffentlichen Leben nahezu vollständig verschwand. Die Regierung verschärfte die Überwachung der Bevölkerung, intensivierte die Christenverfolgung und verbot ausländischen Missionaren jeglichen Zutritt zum Land.
In der Folgezeit lebten nur noch kleine Gruppen von Kakure Kirishitan ihren Glauben im Verborgenen weiter, häufig vermischt mit buddhistischen und shintoistischen Elementen, um der Entdeckung zu entgehen.
Der Shimabara-Aufstand war der letzte größere Widerstand christlicher Gruppen in Japan. Er besiegelte für über zwei Jahrhunderte das Schicksal des Christentums im Land und führte zur vollständigen Abschottung Japans während der Edo-Zeit.

-
Das Gion-Mamori , das Wappen des Gion-Schreins , das zwei sich kreuzende Schriftrollen und ein Horn darstellt, wurde von den Kakure Kirishitan unter dem Tokugawa-Shogunat als Wappen übernommen.
Bild © hand drawn on Adobe Photoshop by 白拍子花子, Gion Mamori Inverted, CC BY-SA 4.0
Kakure Kirishitan: Die verborgenen Christen Japans
Nach dem Verbot des Christentums und der brutalen Christenverfolgung zogen sich viele Gläubige in den Untergrund zurück. Diese sogenannten Kakure Kirishitan – „verborgene Christen“ – hielten ihren Glauben über Jahrhunderte heimlich am Leben.
Wie Christen ihren Glauben im Geheimen weiterlebten
Die Kakure Kirishitan lebten in abgeschiedenen Regionen, etwa auf den Gotō-Inseln oder in Nagasaki. Ihre Existenz war von ständiger Angst geprägt, entdeckt zu werden.
So praktizierten sie ihren Glauben im Verborgenen, überlieferten Gebete mündlich und hielten Zeremonien heimlich im Kreis der Familie ab. Christliche Symbole wurden versteckt oder so angepasst, dass sie wie buddhistische Figuren erschienen – etwa die berühmte Maria Kannon, die äußerlich die Gestalt der buddhistischen Göttin Kannon annahm.
Religiöse Rituale im Verborgenen
Die Kakure Kirishitan entwickelten einzigartige Formen der Religionsausübung, die Elemente des katholischen Glaubens mit buddhistischen und shintoistischen Praktiken verbanden. Dadurch passten sie sich der religiösen Umgebung an und erschwerten es den Behörden, sie zu entlarven.
Da es keine Priester mehr gab, übernahmen Laien die religiösen Aufgaben. Gebete wurden oft in einer veränderten Form des Portugiesischen oder Latein gesprochen, deren Bedeutung nur noch mündlich weitergegeben wurde. Taufen und Gottesdienste fanden im kleinsten Kreis statt – immer mit der Angst, entdeckt zu werden.

-
Historischer christlicher Friedhof auf der Insel Kashiragashima
Foto © Indiana jo - wikimedia
Das Erbe der Kakure Kirishitan
Über Jahrhunderte hinweg hielten die Kakure Kirishitan an ihrem Glauben fest, obwohl sie vollkommen isoliert waren und keinerlei Kontakt zur römisch-katholischen Kirche unterhalten konnten.
Erst mit der Öffnung Japans in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und der Aufhebung des Christenverbots wagten sich einige dieser Gemeinschaften wieder an die Öffentlichkeit.
Einige kehrten zum offiziellen Katholizismus zurück. Andere behielten ihre eigenständigen religiösen Traditionen bei, die sich mittlerweile so stark verändert hatten, dass sie kaum noch als katholisch im engeren Sinn zu bezeichnen waren. Diese Gruppen werden heute teilweise als Hanare Kirishitan („abgespaltene Christen“) bezeichnet.
Das Schicksal der Kakure Kirishitan ist ein eindrucksvolles Zeugnis für die Ausdauer des Glaubens unter widrigsten Bedingungen. Bis heute erinnern Museen und Gedenkstätten in der Region Nagasaki an ihre Geschichte. Mehrere Stätten, darunter Kirchen und Dörfer, wurden 2018 sogar als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt.
Das Christentum kehrt zurück: Meiji-Restauration und Religionsfreiheit (ab 1868)
Mit der Meiji-Restauration 1868 öffnete sich Japan erneut dem Westen. Teil dieser Öffnung war die Aufhebung des jahrhundertelangen Verbots des Christentums. 1873 wurde das Verbot offiziell aufgehoben, wodurch Missionare ihre Arbeit wiederaufnehmen konnten. Auch die Nachfahren der Kakure Kirishitan durften ihren Glauben nun offen praktizieren.
Legalisierung des Christentums in Japan
Die Aufhebung des Verbots war ein politisches Zugeständnis an westliche Nationen, brachte jedoch auch für die japanische Gesellschaft neue Impulse. Die katholische und protestantische Missionstätigkeit wurde wieder aufgenommen. Kirchen entstanden zunächst in Nagasaki und Yokohama – Städten mit starkem westlichen Einfluss.
Aufbau erster Kirchen und Missionsschulen
In den Folgejahren wurden zahlreiche Kirchen gebaut. Die Ōura-Kirche in Nagasaki (geweiht 1865) ist heute die älteste erhaltene Kirche Japans und UNESCO-Weltkulturerbe. Besonders in Kyūshū entstanden viele Gotteshäuser, von denen einige noch heute aktiv genutzt werden.
Parallel gründeten Missionare christliche Schulen und Universitäten. Ein Beispiel ist die Dōshisha-Universität in Kyoto (1875). Diese Einrichtungen trugen wesentlich zur Verbreitung westlicher Bildung und moderner Wissenschaft in Japan bei.

-
Die katholische Ōura-Kathedrale (Ōura Tenshudō), die älteste noch existierende christliche Kirche Japans, erbaut 1864.
Foto © inunami - nagasaki, CC BY 2.0
Wie viele Kirchen gibt es in Japan?
Heute gibt es in Japan rund 3.000 christliche Kirchen, die meisten davon katholisch oder protestantisch. Besonders im Süden, in Nagasaki, findet man eine hohe Dichte historisch bedeutender Kirchen.
Christliche Schulen in Japan
Bis heute betreiben christliche Organisationen eine Vielzahl an Bildungseinrichtungen: Grundschulen, weiterführende Schulen und Universitäten. Diese Schulen sind für ihre qualitativ hochwertige Ausbildung bekannt und genießen einen exzellenten Ruf.
Christliche Werte wie Nächstenliebe, Verantwortungsbewusstsein und humanitäres Engagement spielen an diesen Schulen eine zentrale Rolle, auch wenn viele der Schüler selbst keiner christlichen Konfession angehören.
Die schönsten und ältesten Kirchen in Japan: Architektur und Bedeutung
Die Architektur japanischer Kirchen kombiniert westliche Stile mit traditionellen japanischen Elementen, was ihnen einen besonderen Charakter verleiht.
- Ōura-Kirche (Nagasaki)
Älteste erhaltene Kirche Japans (1864), UNESCO-Weltkulturerbe, bekannt für die Entdeckung der „verborgenen Christen“. - Urakami-Kathedrale (Nagasaki)
Früher größte Kathedrale Asiens, 1945 durch die Atombombe zerstört, später originalgetreu wiederaufgebaut. - Shitsu-Kirche (Gotō-Inseln)
1882 von französischen Missionaren erbaut, Teil des UNESCO-Welterbes, Zentrum einer früheren Kakure Kirishitan-Gemeinde. - Egami-Kirche (Gotō-Inseln)
1918 errichtet, symbolisiert die Rückkehr der Christen aus dem Untergrund, schlichte Architektur in Holzbauweise. - Kurosaki-Kirche (Gotō-Inseln)
Gegründet 1920, typische Kombination westlicher und japanischer Baustile, aktives Gemeindeleben. - Immaculate Conception Cathedral / Urakami-Kathedrale (Nagasaki)
Nach dem Atombombenabwurf 1959 neu errichtet, bewahrt Überreste der zerstörten Originalkirche. - Motomiya Kirche (Amakusa-Inseln)
Erinnerungsort an die christliche Gemeinschaft der Amakusa-Region, die am Shimabara-Aufstand beteiligt war. - Nakanoura Kirche (Gotō-Inseln)
1925 erbaut, liegt idyllisch am Meer, Beispiel für die bescheidene Architektur der christlichen Dörfer. - Kosuge Kirche (Tokyo)
Eine der ältesten katholischen Kirchen in Tokyo, gegründet im 19. Jahrhundert, kleines, lebendiges Gotteshaus. - Dōshisha Chapel (Kyoto)
Auf dem Campus der Dōshisha-Universität, wichtiges Symbol für den protestantischen Glauben in Japan.
Christen in Japan heute: Zahlen, Fakten und Religion
Wie viele Christen leben heute in Japan?
Das Christentum bleibt in Japan eine Minderheitsreligion. Aktuellen Schätzungen zufolge gibt es heute rund 1 bis 1,5 Millionen Christen im Land. Das entspricht etwa 1 % der Gesamtbevölkerung.
Verteilung der Christen: Katholiken und Protestanten
Die japanischen Christen verteilen sich auf mehrere Konfessionen:
- Rund 000 sind Katholiken. Die meisten katholischen Gemeinden finden sich im Süden Japans, insbesondere in der Region Nagasaki, die historisch das Zentrum des japanischen Christentums war.
- Etwa 000 bis 800.000 gehören protestantischen Kirchen an. Diese sind in ganz Japan verbreitet und betreiben zahlreiche Schulen und Universitäten.
- Es gibt zudem kleinere orthodoxe Gemeinden, die vor allem in den Großstädten zu finden sind.
Japan Christentum in Prozent, Anteil und Anzahl im Vergleich
Vergleich des Christentums (1% der Bevölkerung) zu den beiden großen Religionen des Landes:
- Shintoismus: Etwa 70–80 % der Bevölkerung nehmen an schintoistischen Ritualen teil, oft im Zusammenhang mit Lebensereignissen wie Geburt oder Neujahr.
- Buddhismus: Rund 65–70 % der Japaner befolgen buddhistische Traditionen, vor allem bei Beerdigungen und Ahnenverehrung.
Viele Japaner folgen beiden Religionen gleichzeitig, ohne sich im westlichen Sinne zu einer Religion zu bekennen. Nur etwa 30 % der Bevölkerung bezeichnen sich explizit als religiös.
Christentum in Japan zwischen Tradition und Moderne
Nach der wechselvollen Geschichte stehen christliche Gemeinden in Japan heute vor der Herausforderung, ihren Platz in einer weitgehend säkularen Gesellschaft zu behaupten. Religion spielt für viele Japaner nur eine geringe Rolle im Alltag.
Christliche Kirchen leisten weiterhin wichtige Beiträge in Bildung, Soziales und Menschenrechte. Schulen, Universitäten und Krankenhäuser in kirchlicher Trägerschaft genießen einen hervorragenden Ruf.
Glossar wichtige Begriffe
Kakure Kirishitan
„Verborgene Christen“ – japanische Christen, die ihren Glauben während des Verbots im Geheimen weiter praktizierten.
Shimabara-Aufstand
Ein Bauern- und Christenaufstand in den Jahren 1637–1638 gegen das Tokugawa-Shogunat. Er endete mit einer brutalen Niederschlagung.
Sakoku
Die „Abschließung Japans“ – eine Politik des Tokugawa-Shogunats, die Japan für rund 220 Jahre (ca. 1639–1853) weitgehend von der Außenwelt abschottete.
Franz Xaver
Ein Mitbegründer des Jesuitenordens und einer der ersten Missionare, die das Christentum im Jahr 1549 nach Japan brachten.
Das könnte Sie auch interessieren:
Die zwölf wichtigsten japanischen Götter und Göttinnen
Religionen in Japan – von Shinto bis Buddhismus
Die berühmtesten und berüchtigtsten Samurai Japans
Titelfoto © japanwelt.de
Passende Artikel

Kimono - SensuTake
Kimono SensuTake in schwarz, grün, rot oder blau aus satinierter Baumwolle, 55"
132,00 € *
Inhalt: 1
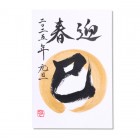
Glückwunschkarte mit handgemalter Kalligraphie zum Jahr...
Diese Kalligraphie Zeichnung im Postkartenformat wird von der japanischen Künstlerin Imako Umesaka (Künstlername: Suikin) angefertigt. Es handelt sich um einen Neujahrsgruß mit dem japanischen Schriftzeichen der Schlange aus dem asiatischen Mondkalender. Inspiriert vom japanischen Tierkreiszeichen symbolisiert diese Kalligraphie Eleganz, Erneuerung und Harmonie. Produkteigenschaften japanische Kalligraphie Jahr...
29,00 € *
Kommentar schreiben