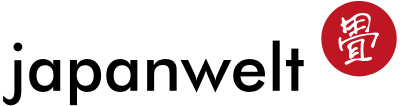Yakuza – Die geheimnisvolle Welt der japanischen Mafia erklärt
Yakuza – da denkt man schnell an japanische Mafiosi, dreckige Geschäfte und tödliche Feuergefechte. Das trifft allerdings nur teilweise zu und stammt, wie so viele Auffassungen über die japanische Gesellschaft und ihre Traditionen, vor allem aus der popkulturellen Vermittlung durch Filme, populäre Bücher und teils sogar Videospiele.
Wir stellen Ihnen hier die Yakuza im Detail vor und werfen sowohl einen Blick in die Vergangenheit dieser kriminellen Organisationen als auch auf deren ungewisse Zukunft.
Was ist die Yakuza?
Die Yakuza (ヤクザ) ist eine in Japan entstandene Form des organisierten Verbrechens mit strenger Hierarchie und einem ausgeprägten Ehrenkodex. Ursprünglich ging sie wohl aus zwei diskriminierten Berufsgruppen hervor. Lange Zeit waren die – auch international agierenden – Yakuza die wichtigsten Unterweltgruppen in Japan.
Oft werden sie mit der italienischen Mafia verglichen und im Westen, auch durch die popkulturelle Vermittlung, als ebenso skrupellos und gewalttätig angesehen. Das trifft jedoch nicht in allen Punkten zu. Die Rolle und das Verhalten der Yakuza in der japanischen Gesellschaft sind deutlich komplexer.

-
Taoka Kazuo (Mitte), der japanische „Pate“. Er machte aus der Yamaguchi-gumi Gruppe die größte kriminelle Organisation Japans, zeitweise sogar weltweit.
Foto © Unknown author, Taoka, gemeinfrei, Wikimedia Commons
Der Begriff Yakuza – sie selbst nennen sich Ninkyō Dantai (任侠団体; wörtlich: „ritterliche Organisation“) – stammt vom traditionellen Kartenspiel Oicho-Kabu (おいちょかぶ). Er steht für die Zahlenfolge 8-9-3, die in diesem Kartenspiel eine wertlose Hand darstellt. Der Begriff wird sowohl als Oberbegriff für diese Form der Verbrechersyndikate als auch für einzelne Mitglieder verwendet.
Zudem verweist er mit der genannten Zahlenfolge direkt auf eine der marginalisierten Berufsgruppen – die Glücksspielanbieter –, aus denen die Yakuza historisch hervorgingen.
Anders als man erwarten würde, ist die Yakuza auch heute nicht verboten. Sie wird lediglich als Bōryokudan (暴力団; „gewalttätige Gruppen“) eingestuft und von der Polizei offiziell nur noch so bezeichnet. Im Volksmund hat sich der Begriff Yakuza jedoch bis heute gehalten.
In ihrem Wirkungsbereich betreiben Yakuza-Syndikate durchaus offizielle Büros. Der Hintergrund für diesen anderen Umgang mit Japans traditioneller Form der organisierten Kriminalität liegt vor allem in der Geschichte.
Teilweise war die Yakuza sogar zu manchen Zeiten sozusagen akzeptiert – zumindest solange sie sich an gewisse Rahmenbedingungen hielt. Das lag daran, dass sie als regulierbare Form der Kriminalität angesehen wurde und die bestehenden Macht- und Klassenverhältnisse nie infrage stellte. So war die organisierte Kriminalität in Form der Yakuza, die lange die einzigen Syndikate dieser Art in Japan waren, besser kontrollierbar. Große Teile der unvermeidlichen Kriminalität konnten so in feste Bahnen gelenkt werden.
Was steckt hinter dem Ehrenkodex der Yakuza – Loyalität, Ehre und Gehorsam
Die Yakuza besitzen einen ausgeprägten Ehrenkodex, der als Ninkyō-dō („Weg des ritterlichen Mitgefühls“) bezeichnet wird. Historisch bestimmte dieser Kodex stark alle Handlungen der Organisationen.
Im Zentrum stehen Loyalität, Ehre und Gehorsam. Absolute Loyalität und Gehorsam werden dabei gegenüber dem Oyabun (親分; in etwa: „Ziehvater“) eingefordert – der Führungsfigur eines Yakuza-Syndikats. Die anderen Mitglieder heißen Kobun (子分; in etwa: „Ziehsohn“).
Der ebenso wichtige Ehrbegriff wie das Ideal der Ritterlichkeit – beides schon im Begriff des Ehrenkodex enthalten – sind teilweise an historische Samurai-Prinzipien angelehnt. Dazu gehört auch eine teils drastische Bestrafung bei Missachtung des Kodex.
Historisch war dieser Ehrenkodex der wichtigste Leitfaden für das Verhalten der einzelnen Yakuza und der Organisationen insgesamt. Absolute Treue, Ehre, Disziplin und Aufopferung für die eigene Gruppe waren lange Zeit wichtiger als Geld, Status und Macht.
Dies hat sich im Laufe der Zeit jedoch verändert. Heute nutzen viele Yakuza-Syndikate zumindest Teile des Ehrenkodex oft nur noch als Fassade oder lösen sich ganz bzw. teilweise von ihm.
Diese Entwicklung hängt unter anderem mit der Internationalisierung des Verbrechens (z. B. Drogenhandel), neuer Technologie, digitalen Verbrechensformen und dem Niedergang der Organisation zusammen. Besonders schwer wiegt, dass die Yakuza immer weniger neue Mitglieder rekrutieren können und so zunehmend überaltern – ähnlich wie die japanische Gesellschaft insgesamt.
Heute stehen oft finanzielle Interessen im Vordergrund, nicht mehr der antiquierte Ehrenkodex.
Wie funktioniert die Yakuza? – Aufbau und Struktur der japanischen Mafia
Die Yakuza funktioniert nach einem streng hierarchischen System. An der Spitze eines Syndikats steht immer der Oyabun. Ihm sind alle vollwertigen Mitglieder, die Kobun, unterstellt.
Unter den Kobun gibt es weitere Abstufungen – einige übernehmen Rollen wie Berater, Bereichsleiter oder rechte Hand und stehen damit in der Hierarchie höher.
Die Organisation ist zudem in Untereinheiten gegliedert, die für bestimmte Geschäftsfelder wie Finanzen, Schutz oder Erpressung zuständig sind. Neben den Kobun gibt es viele nicht vollwertige Mitglieder, die gewöhnlichen Berufen nachgehen oder kleine Geschäfte betreiben.
Große Syndikate arbeiten oft nach einem System, bei dem einem obersten Oyabun kleinere Oyabun unterstellt sind, die Ableger der Mutterorganisation leiten. In gewisser Weise ähnelt der Aufbau damit großen Unternehmen – mit Aufsichtsrat, Vorstand, Bereichsleitern und Tochtergesellschaften.
Die heute größten Yakuza-Gruppen sind Yamaguchi-gumi, Sumiyoshi-kai und Inagawa-kai. Jede verfügt über zahlreiche Unterorganisationen und dominiert die Szene.
Allerdings schrumpft die Zahl der Mitglieder seit Jahren. In den 1990er Jahren gab es schätzungsweise 90.000 oder mehr Mitglieder. Heute sind es vielleicht noch rund 24.000 – also nur etwas mehr als ein Viertel.
Was macht die Yakuza? – Aktivitäten zwischen Legalität und Verbrechen
Die Aktivitäten der Yakuza bestehen nicht nur aus illegalen Geschäften. Sie umfassen auch legale Unternehmungen sowie solche, die sich in Grauzonen bewegen.
Diese Mischung war schon immer Teil ihrer Strategie und wird heute auch von vielen internationalen Verbrecherorganisationen praktiziert. Spätestens für Geldwäsche und Investitionen ihrer Gewinne benötigen sie legale Standbeine.

-
Wie überall auf der Welt beherrscht die Organisierte Kriminalität die Rotlichtbezirke in den großen Städten. Foto von Nicolas Lindsay auf Unsplash
Illegale Aktivitäten der Yakuza umfassen vor allem:
- Drogenhandel
- Erpressung
- Illegales Glücksspiel
- Schutzgelderpressung
- Prostitution
- Waffenschmuggel
Legale Aktivitäten der Yakuza umfassen vor allem:
- Immobiliengeschäfte
- Finanzwesen
- Baufirmen
- Sicherheitsunternehmen
Grauzonen, in denen sich die Yakuza bewegt:
- Katastrophenhilfe (z. B. nach dem Tsunami 2011), verstanden als Teil des ritterlichen Kodex und traditionell ohne Erwartung finanziellen Gewinns.
- Auftreten als inoffizielle Ordnungsmacht bei Straßenkonflikten – dabei übernehmen sie teils polizeiähnliche Aufgaben.
Yakuza und die Polizei – Warum Japans Mafia lange geduldet wurde
Die Beziehung zwischen Yakuza und Polizei war lange Zeit ungewöhnlich. Man duldete sich gegenseitig und half sich in Einzelfällen sogar – wenn auch mit Distanz.
Von Behörden und Politik wurden die Yakuza lange Zeit akzeptiert, was historische Gründe hatte. Diese Duldung verhinderte zudem die Entstehung anderer krimineller Organisationen.
Historisch gehen die Yakuza auf die Tekiya (Hausierer, Hehler, Straßenverkäufer) und Bakuto (Veranstalter illegaler Glücksspiele) zurück. Beide Gruppen standen am Rand der Gesellschaft und wurden stark marginalisiert.
Rituale und Strafen, die aus dieser Zeit stammen, dienten der Festigung der Gruppenidentität. Ein Ausschluss bedeutete damals oft den Hungertod. Dennoch ließ man diesen Randgruppen eine Existenz, solange sie die öffentliche Ordnung nicht störten.
Diese Logik übertrug sich auf die Yakuza.
Eine deutliche Änderung im Umgang kam erst in den 2000er Jahren. Strengere Gesetze, die Einstufung als Bōryokudan („gewalttätige Gruppen“) und öffentliche Ächtung führten zu einer zunehmenden Verdrängung der Yakuza.
Typische Merkmale und Symbole der Yakuza
Die Yakuza besitzen bestimmte Symbole und Merkmale, an denen man sie erkennen kann. Dazu gehören auch archaisch wirkende Rituale.
Yubitsume – das ritualisierte Abschneiden eines Fingers
Yubitsume (指詰め; „Fingerverkürzung“) ist ein traditionelles Ritual der Yakuza. Dabei schneidet sich ein Mitglied zur Abbitte gegenüber dem Oyabun und den anderen Kobun den kleinen Finger oder einen Teil davon ab – in der Regel an der nicht-dominanten Hand. Dies kann freiwillig oder angeordnet geschehen, meist als Strafe für ein Vergehen gegen die Organisation.
Der Ursprung liegt bei den Bakuto, die diese Art der Bestrafung als Ersatz für nicht beglichene Spielschulden nutzten.
Hintergrund ist die japanische Schwertkampfkunst: Der Verlust des kleinen Fingers erschwert die beidhändige Führung eines Katana-Schwertes und senkt die Verteidigungsfähigkeit. Bei den Yakuza gilt Yubitsume als Zeichen der Reue, kann aber auch als Bestrafung oder als Loyalitätsbeweis dienen.

-
Yakuza-Schrein in Asakusa, Tokio. Nach japanischem Recht dürfen Yakuza oder japanische Mafia ihre Tätowierungen nur bei einem Sansha Matsuri (Festival) öffentlich zeigen.
Foto © by apes_abroad -, CC 表示-継承 2.0
Irezumi – Traditionelle Ganzkörpertätowierungen
In Japan gibt es eine alte Tattoo-Kultur, dennoch werden Tattoos heute oft kritisch gesehen. Ein Grund ist das Irezumi (入れ墨) – traditionelle, großflächige Ganzkörpertätowierungen, die viele Yakuza tragen.
Gesicht und Hände bleiben meist frei, um die Tattoos bei Bedarf verbergen zu können. Die Motive – häufig japanische Drachen, Kirschblüten oder Tiger – besitzen eine symbolische Bedeutung: Sie können die Hingabe zur Organisation, den Rang oder die Zugehörigkeit ausdrücken.
Etwa zwei Drittel der modernen Yakuza folgen dieser Tradition, oft mit aufwendiger Handarbeit mittels Bambusnadeln.
Zeremonien und interne Rituale der Yakuza
Die Yakuza pflegen zahlreiche Zeremonien und interne Rituale. Sie dienen der Bekräftigung der Gruppenzugehörigkeit, der Loyalität und der Disziplin.
Eine der wichtigsten ist die Aufnahmezeremonie: Nach einer harten Lehrzeit wird der Anwärter mit einer Sake-Zeremonie als vollwertiges Mitglied aufgenommen. Dieser Schritt ist bindend und nur durch Strafe oder Ausschluss umkehrbar.
Weitere Rituale betreffen Loyalitätsschwüre oder Strafen wie das oben beschriebene Yubitsume. Viele dieser Bräuche stammen direkt von den Tekiya und Bakuto.
Yakuza-Kleidung – Zwischen Anzug und Unsichtbarkeit
Der klassische Kleidungsstil der Yakuza umfasst Anzüge, oft kombiniert mit Sonnenbrillen und gegelten Haaren – fast wie eine Uniform.
Bei bestimmten Anlässen, etwa Festivals, präsentieren sie stolz ihre Tattoos.
Heute verhalten sich viele Yakuza jedoch in der Öffentlichkeit unauffälliger und kleiden sich weniger uniform, um nicht aufzufallen.

-
Der Status der Yakuza ist deutlich an ihren Tätowierungen zu erkennen. Sanja Matsuri Festival in Japan, 2007 - Foto © elmimmo, Yakuza at Sanja Matsuri, CC BY 2.0
Der langsame Niedergang der japanischen Mafia – Das Ende einer Ära?
Die Yakuza leidet unter mehreren Problemen, die zu ihrem langsamen, aber stetigen Niedergang führen.
Strengere Gesetze und stärkere Verfolgung seit den 2000er Jahren beschleunigen diesen Prozess. Ein Hauptproblem ist die Rekrutierung: In den 1990er Jahren gab es noch rund 90.000 Mitglieder (Stand 1992), heute sind es nur noch etwa 24.000. Dies führt zu Überalterung und einem Verlust an Einfluss.
Hinzu kommt die gesellschaftliche und gesetzliche Stigmatisierung durch die Anti-Yakuza-Gesetze. Diese beinhalten Registrierungspflichten und den Ausschluss vom Zugang zu Banken, Mietverträgen und Versicherungen. Das erschwert die Arbeit der Organisation und macht einen Beitritt für junge Menschen unattraktiv.
Als Reaktion ziehen sich viele Gruppen aus der Öffentlichkeit zurück, verlagern Aktivitäten ins Cybercrime oder ins internationale Geschäft, um bestehende Hürden zu umgehen.
Die andere Seite der Yakuza – Was passiert, wenn man aussteigen will?
Ein Ausstieg ist in der Yakuza traditionell nicht vorgesehen. Mitgliedschaft gilt lebenslang, es sei denn, ein Mitglied wird wegen schwerer Vergehen ausgeschlossen.
Es gibt Fälle freiwilligen Ausstiegs, doch auch diese Ex-Yakuza leiden unter denselben Problemen wie Ausgestoßene: gesellschaftliche Stigmatisierung, Job- und Wohnungslosigkeit, kein Zugang zu Bankkonten.
Der japanische Staat bietet Reintegrationsprogramme an und unterstützt nichtstaatliche Initiativen. Trotzdem bleiben viele Ex-Yakuza gesellschaftliche Außenseiter – auch wenn dies heute nicht mehr den Hungertod bedeutet wie zu Zeiten der Tekiya und Bakuto.
Was ist aus der Yakuza im heutigen Japan geworden?
Heute fällt es der Yakuza schwer, ihre einstigen Einflussbereiche zu halten. Die Organisation befindet sich in einem langsamen historischen Verfall. Die Macht schwindet, und die gesellschaftliche Ablehnung wächst. Banken, Vermieter und Versicherer verweigern Yakuza meist ihre Dienste, was die Isolation verstärkt.
Gleichzeitig oszilliert die mediale Darstellung zwischen Faszination und Kritik. Yakuza-Filme sind in Japan ein eigenes Genre, Mangas und Computerspiele greifen das Thema ebenfalls auf.
Seit den Gesetzesverschärfungen der 2000er Jahre geht die Polizei härter vor, setzt aber in Einzelfällen auch weiterhin auf tolerantere Strategien.
Von Hollywood bis Videospiel – Warum die Yakuza zur Pop-Ikone wurde

-
In der japanischen Popkultur wird der Yakuza zum Klischee: Elegante Anzüge, geheimnisvolle Aura und düstere Atmosphäre.
Foto © Guren-The-Thirdeye auf Pixabay
Yakuza-Filme stellen die Mitglieder entweder als „ehrbare Männer“ oder als brutale Verbrecher dar.
Regisseure wie Kinji Fukasaku (bekannt durch die Battle Royale-Filme) und Takeshi Kitano (u. a. Hana-Bi, Zatoichi) prägten das Genre. Selbst Akira Kurosawa widmete den Yakuza mehr als einen Film.
Die Faszination reichte bis nach Hollywood – Beispiele sind Black Rain, The Punisher oder Johnny Mnemonic.
Auch in Literatur, Anime und Manga finden sich Yakuza-Themen. Besonders bekannt ist die internationale Videospielreihe „Yakuza“ (Like a Dragon) von SEGA. Ihre Symbolik hat sogar die japanische Popkultur beeinflusst – von Streetwear über Musik bis hin zur Kunst.
Das könnte Sie auch interessieren:
Gefährliche Orte in Japan – welche Sicherheitsrisiken gibt es für Touristen?
Jōhatsu – Warum Menschen in Japan freiwillig verschwinden
Verbote, wichtige Regeln und Gesetze, die man in Japan kennen sollte
Die 15 wichtigsten Verhaltensregeln für Japan
Titelfoto © Japanwelt
Passende Artikel

Samurai Regenschirm
Jeder Samurai braucht ein Schwert und einen Regenschirm! Warum nicht beides gleichzeitig haben? Der Samurai-Regenschirm ist ein lustiges kleines Gimmick für Japan- und Cosplay-Fans. Es handelt sich dabei um einen relativ großen Regenschirm mit einem Durchmesser von 100cm im ausgebreiten Zustand. Herzstück des schwarzen Schirms ist der lange Griff, welches aus Kunststoff ist, aber die Form eines Samurai-Schwertes nachahmt....
ab 23,00 € *
Inhalt: 1 Stück

Japanwelt Wundertüte "Fukubukuro" - Japan
Fukubukuro mit Thema Japan stehen für verschiedene Artikel aus dem Japanwelt-Sortiment. Sie erhalten ein gemischtes Set von japanischen Artikeln. Moderne und Tradition werden in den Glückstaschen vereint. Sie wissen zwar nicht, welche Artikel aus dem Japanwelt-Sortiment wirklich enthalten sind, Sie werden aber ein Schnäppchen machen. Der Warenwert der Lucky Bag übersteigt den Kaufpreis deutlich. Seit Beginn des 20....
Statt: 27,50 € * ab 22,00 € *
Inhalt: 9.0000

monbento Original 1 l - Bento Box
Hochwertige Bento Boxen aus Kunststoff können Sie seit Jahren von der französischen Marke monbento kaufen. Die Lunch Boxen sind im japanischen Stil gehalten. Die klassische Bento Box aus Japan ist eine Frischhaltedose für das Mittagessen. Es handelt sich um das asiatische Pendant zu den deutschen Brotdosen. In Japan werden zum Mittag jedoch Reis, Gemüse, Fleisch und verschiedene Soßen verzehrt, die alle in der Lunch...
42,90 € *
Inhalt: 1.0000
Kommentar schreiben