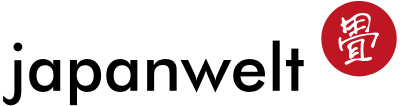Baisao: Der alte Teeverkäufer als Pionier der Sencha-Teekultur
Die in Japan vor allem unter seinem Spitznamen Baisao (賣茶翁, 1675-1763), „der alte Teeverkäufer“, bekannte historische Figur brachte den Japanern das Trinken von Grüntee in loser Blattform nahe. Zuvor wurde in Japan fast ausschließlich Grüntee in Pulverform, also Matcha, getrunken. Diese neue Form des Tees verbreitete sich schnell und erlangte hohe Popularität. Bis heute ist Sencha der am häufigsten getrunkene Tee in Japan.
Sencha bezeichnet dabei sowohl die Zubereitung von Grüntee in loser Blattform als auch die Methode der Herstellung, bei der der Tee zur Vermeidung von Oxidation bedampft und nicht geröstet wird. Gleichzeitig ist Sencha auch der Name für eine spezielle Sorte des japanischen Grüntees.
Die von Baisao genutzte Zubereitungsmethode orientierte sich am chinesischen Gong-fu-cha-Teestil. Nach seinem Tod wurde diese Methode – entgegen seinem Willen – formalisiert und zu einer eigenen Form der Teezeremonie, dem sogenannten Senchado, erweitert. Deshalb wird Baisao heute zurecht als Pionier der Sencha-Teekultur und Vater des Senchado angesehen. Doch Baisao war nicht nur Teemeister. Er war auch ein Kalligraph und Dichter, dessen Werke teilweise bis heute erhalten geblieben sind.
Baisao’s frühes Leben und buddhistische Prägung
Der alte Teeverkäufer Baisao wurde 1675 unter dem Namen Shibayama Kikusen in der Stadt Hasuike geboren. Diese lag in der historischen Hizen-Provinz (heute die Präfekturen Saga und Nagasaki) auf der Insel Kyushu. Sein Vater starb, als Baisao erst neun Jahre alt war. Im Alter von 11 Jahren trat er in den Ryushini-Tempel der Obaku-Schule des Zen-Buddhismus ein und wurde Mönch. Dort nahm er den Namen Gekkai Gensho an.
Die Obaku-Schule des Zen-Buddhismus war damals noch recht jung. Sie wurde von dem aus China stammenden Mönch Ingen gegründet und orientierte sich stärker an chinesischen Vorbildern als andere Zen-Schulen in Japan. Ingen brachte nicht nur buddhistisches Wissen mit, sondern auch die Tradition des Grüntees in loser Blattform. Einer seiner Schüler, Kerin Doryo, wurde später der Lehrer von Baisao.
Bereits 1696, im Alter von nur 21 Jahren, begann Baisao als buddhistischer Mönch, durch Japan zu reisen. Er besuchte verschiedene Tempel, um dort zu studieren und zu meditieren. Nach einigen Jahren kehrte er in seinen Heimattempel zurück und wurde dessen Intendant. Diese Position hielt er bis 1723 inne. In diesem Jahr starb seine Mutter, und der Tempel erhielt mit Daicho Genko einen neuen Abt.
Im Jahr 1724 verließ Baisao den Heimattempel endgültig und zog nach Kyoto, wo er den Rest seines Lebens verbringen sollte. Dank Empfehlungsschreiben des Abtes knüpfte er dort rasch Kontakte zu vielen Künstlern, Mönchen und Literaten, mit denen er langjährige Freundschaften pflegte.

-
Gedenkstele zu Ehren von Baisao in seinem Geburtsort (Ryushin-ji).
Foto © Pekachu, Honoring monument for Baisao at Ryushin-ji Saga, CC BY-SA 4.0
Baisao’s Übergang vom Mönch zum Teeverkäufer
In seinem neuen Wohnort Kyoto begann Baisao um das Jahr 1735 herum – also nach über zehn Jahren dort – Tee in den Straßen zu verkaufen. Es handelte sich nicht um den damals bekannten Matcha, sondern um mit losen Teeblättern aufgegossenen Grüntee. Baisao nutzte dabei die ihm aus dem Tempelleben bekannte, an der chinesischen Gong-fu-cha-Methode angelehnte Technik der Teezubereitung. Zu dieser Zeit hatte sich Baisao noch nicht formell von seinem Leben als Mönch zurückgezogen, wie er es rund zehn Jahre später tun sollte.
Baisao lebte asketisch und bewohnte eine kleine Hütte am Kamo-Fluss. Seinen Tee verkaufte er eigentlich nicht, sondern bereitete ihn an malerischen Plätzen in Kyoto öffentlich zu und schenkte ihn den Passanten aus. Als Gegenleistung konnte man ihm eine Spende hinterlassen, die seinen Lebensunterhalt sicherte.
Die Gründe, warum Baisao seinen Tempel verließ und das Leben eines Teeverkäufers annahm, lagen vermutlich in seiner Unzufriedenheit mit dem Tempelleben und seinem Wunsch, Zen im Alltag zu leben und den Menschen direkt nahe zu sein.
Die Einwohner Kyotos, die schnell mit Baisao und seinem ungewöhnlichen Tee vertraut wurden, gaben ihm seinen berühmten Spitznamen. 1745, im Alter von 70 Jahren, legte Baisao formell sein Mönchstum nieder und nahm den Laien-Namen Ko Yugai an. Noch einmal zehn Jahre später, 1755, beendete er den öffentlichen Teeverkauf. Zu diesem Zeitpunkt war Sencha bereits in aller Munde.
Baisao und die Einführung von Sencha
Sencha (煎茶) ist im Japanischen ein mehrdeutiger Begriff. Er bedeutet wörtlich „aufgegossener Tee“ und bezieht sich sowohl auf die Zubereitungsmethode als auch auf den Grüntee in loser Blattform, der durch Bedampfung vor Oxidation geschützt wird. Diese Methode entwickelte ein japanischer Teebauer noch zu Baisao’s Lebzeiten, und Baisao lobte sie sehr. Heute bezeichnet Sencha sowohl den Oberbegriff für gedämpften Grüntee in loser Blattform als auch eine bestimmte Tee-Sorte.
Der zuvor in Japan übliche Matcha ist zu feinem Pulver zermahlener Grüntee, der meist aus einem Tencha-Schattentee hergestellt wird. Im Gegensatz zu Sencha wird Matcha nicht einfach aufgegossen, sondern mithilfe eines Chasen (eines aus Bambus gefertigten Teebesens) in einer Matcha-Schale mit heißem Wasser zu einer Emulsion aufgeschlagen.
Als Baisao nach Kyoto kam, war Tee in loser Blattform dort weitgehend unbekannt. Seine Zubereitung und der Genuss dieses Tees wurden durch Baisao bekannt gemacht und gewannen rasch an Popularität. Schon 1738, also nur etwa drei Jahre nach Beginn seines „Teeverkaufs“, entwickelte ein Teebauer aus Uji bei Kyoto die Bedampfungsmethode für Grüntee, die für die Herstellung von Sencha bis heute prägend ist.
Die Zubereitungsmethode, die Baisao verwendete, orientierte sich an der in der Obaku-Schule des Zen-Buddhismus verbreiteten, ursprünglich aus China stammenden Technik, die spätestens seit der Ming-Dynastie (1368-1644) existierte. Die Zubereitung von Sencha unterschied sich deutlich von der des fast ausschließlich getrunkenen Matcha und der damit verbundenen traditionellen japanischen Teezeremonie, dem Chanoyu.
Der Genuss von Sencha war wesentlich einfacher und nicht durch formale Rituale verkompliziert. Dies machte ihn besonders bei Mönchen und Intellektuellen beliebt. Während das Chanoyu eher einer elitären Zeremonie entsprach, bot Sencha einen unkomplizierten Zugang zum Tee, der für jeden offen war.
Für Baisao war Tee jedoch mehr als ein Getränk. Er betrachtete seine Zubereitung und das Ausschenken als Mittel zur spirituellen Einsicht und sozialen Interaktion, ähnlich wie es auch im klassischen Chanoyu der Fall war.
Baisao’s Lebensweise und Philosophien
Baisao richtete sein Leben in Kyoto nach den Prinzipien des Zen aus, auch wenn er nicht mehr direkt in eine Tempelgemeinschaft integriert war. Sein asketischer Lebensstil, geprägt von Armut und Einfachheit, sowie das Verbreiten der Zen-Lehren bei Gesprächen mit den Menschen waren zentrale Elemente seines Daseins. Seinen Lebensunterhalt bestritt er allein durch seine Rolle als Teeverkäufer, ohne feste Preise zu verlangen. Stattdessen nahm er lediglich Spenden an, sodass jeder in den Genuss seines neuartigen Tees kommen konnte.
Für den Verkauf suchte er sich besonders malerische Orte in Kyoto aus, oft in der Nähe von Tempeln oder Brücken. So wurde „der alte Teeverkäufer“ im Laufe der Zeit zu einer festen Konstante im Stadtbild Kyotos.
Seine Teegeräte, die er zur Zubereitung benötigte, trug Baisao in einem Bambuskorb, den er „Senka“ (Höhle der Weisen) nannte. Der Korb war an einem langen Stock befestigt, den er über der Schulter durch die Straßen trug. Am ausgewählten Ort baute er seine Geräte auf und begann, Tee zuzubereiten und den vorbeikommenden Passanten anzubieten. So kam er täglich mit vielen verschiedenen Menschen in Kontakt, mit denen er sprach und denen er die Zen-Philosophie näherbrachte.
Baisao wurde in Kyoto durch seine Weisheit und Bescheidenheit schnell zu einer bekannten und hochgeschätzten Figur. Er knüpfte viele Bekanntschaften und Freundschaften – sowohl mit Künstlern, Dichtern und Gelehrten als auch mit Teebauern und einfachen Leuten.

-
Detail eines Gemäldes von Baisao, ausgeführt als „sanftes“ Wesen; Tusche und Farben auf Papier; spätes 19. bis frühes 20. Jahrhundert.
Foto © unknown artist, Baisao.painting.detail.01, gemeinfrei, Wikimedia Commons
Baisao und die Kunst in Kyoto
Baisao war nicht nur Mönch und Teeverkäufer, der das Trinken von Tee in Japan revolutionierte, sondern auch ein begabter Dichter und Kalligraph, dessen Werke hoch geschätzt wurden. Seine künstlerische Arbeit orientierte sich an der japanischen und chinesischen Kunst sowie an klassischer Literatur.
Durch seine Bekanntheit und die wachsende Anhängerschaft wurden viele seiner Gedichte, die sich meist mit der Zen-Philosophie und seiner Liebe zum Tee beschäftigten, posthum in Sammlungen veröffentlicht und so für die Nachwelt erhalten. Baisao signierte seine Werke jedoch nie, da ihm die – damals sehr teuren – Siegel fehlten, mit denen Künstler in Japan traditionell ihre Werke stempelten. Erst im hohen Alter von 80 Jahren schenkte ihm ein Siegelmacher die notwendigen Siegelsteine. Diese trugen folgende Inschriften:
- Tsūsen: Weg der Weisheit
- Baisa hachijū-ō: Teeverkäufer, 80 Jahre alt
- Yūgai Koji: Laie Yūgai
Neben seiner Tätigkeit als Dichter und Kalligraph hatte Baisao enge Kontakte zu vielen bedeutenden Künstlern und Gelehrten seiner Zeit. Diese Beziehungen wurden zunächst durch den Abt seines Klosters vermittelt und später durch seine Rolle als Teeverkäufer in Kyoto weiter gefestigt. Er pflegte unter anderem Beziehungen zum Maler Ito Jakuchu und zum Maler und Dichter Yosa Buson, die beide zu den wichtigsten Künstlern der damaligen Epoche gehörten.
Baisao’s Einfluss und Vermächtnis
Die von Baisao populär gemachte Zubereitung von Grüntee in loser Blattform, verbunden mit seiner Betonung von Achtsamkeit und dem Zubereiten sowie Genießen des Tees als quasi spirituellem Akt, legte den Grundstein für die Popularität von Sencha. Diese Tradition führte nach seinem Tod zur Entwicklung der formellen Sencha-Teezeremonie, dem Senchado. Diese Zeremonie wurde schnell zu einer anerkannten Form der japanischen Teekultur und ist bis heute fester Bestandteil des kulturellen Lebens.
Auch seine Teegeräte spielten eine bedeutende Rolle: Nach seinem Tod wurden sie aufgrund bestehender Dokumentationen reproduziert und bildeten die Grundlage für die Entwicklung spezifischer Sencha-Teegeräte. Allerdings versuchte Baisao dies zu verhindern, da er gegen eine Formalierung des Sencha-Trinkens war – ähnlich der traditionellen japanischen Teezeremonie (Chanoyu). Einige Jahre vor seinem Tod ging er sogar so weit, alle seine Teegeräte zu verbrennen, um dies zu vermeiden.
Trotz seines Widerstands trug Baisao maßgeblich dazu bei, dass die japanischen Teegewohnheiten nachhaltig verändert wurden. Durch seine Arbeit wurde die japanische Methode der Bedampfung von Grüntee entwickelt, und Sencha etablierte sich zur beliebtesten Teeform in Japan. Auch die von ihm geprägte Zubereitung, die auf Achtsamkeit und Einfachheit Wert legte, hat bis heute einen festen Platz in der japanischen Tee-Tradition.

- Kimura Kenkado, ein Schüler von Baisao, katalogisierte alle für Senchado nötigen Utensilien – ein Standardwerk.
Foto © Tani Bunchō, A portrait of Kimura Kenkado, gemeinfrei, Wikimedia Commons
Baisao und die Zen-Kultur
Das gesamte Wirken von Baisao ist untrennbar mit dem Zen-Buddhismus verbunden, auch wenn er seinen Tempel verließ und später seine Rolle als Mönch formal niederlegte. Sein Leben war geprägt von einer dem Zen treuen Lebensführung in Einfachheit und materieller Armut.
Die Verbindung der Zen-Philosophie mit dem Akt der Teezubereitung und des Teegenusses spielte eine zentrale Rolle. Bei Baisao war die Zubereitung des Tees eine Übung in Achtsamkeit und eine Form der Meditation. Der Fokus lag auf der Präsenz im Moment, der Einfachheit und der spirituellen Reinigung.
Während er Tee zubereitete, suchte er durch Gespräche mit seinen Kunden immer wieder, die Lehren des Zen-Buddhismus zu vermitteln. In dieser Rolle nahm er eine Art Lehrer-Schüler-Verhältnis ein, wie es im Zen üblich ist. Sein Wirken lässt sich als eine Verbindung von spiritueller Praxis und Alltag deuten – eine Philosophie, die bis heute in der japanischen Teekultur nachklingt.
Baisao’s letzte Jahre
Mit 70 Jahren, im Jahr 1745, legte Baisao seine Rolle als Mönch formal nieder und widmete sich voll und ganz seiner Rolle als „alter Teeverkäufer“. Für etwa ein Jahrzehnt blieb er eine feste Größe im Stadtbild Kyotos.
Mit 80 Jahren, im Jahr 1755, beschloss er jedoch, den Verkauf von Tee einzustellen. In einem symbolischen Akt verbrannte er seine Teeutensilien und -geräte, da er befürchtete, dass nach seinem Tod eine formalisierte Form der Sencha-Zubereitung, ähnlich der traditionellen Teezeremonie (Chanoyu), entstehen könnte.
Obwohl er diese Entwicklung zu verhindern versuchte, begannen nach seinem Tod im Jahr 1763, im stolzen Alter von 88 Jahren, die Entwicklungen zur Etablierung des Senchado. Heute gilt Baisao als der erste Sencha-Teemeister und wird als Pionier dieser wichtigen Teetradition in Ehren gehalten.
Das könnte Sie auch interessieren:
Teeanbaugebiete Japan – Übersicht mit wichtigen Teeplantagen
Japanische Teezeremonie: Tradition, Ablauf & Regeln
Kaiseki Ryori: Die höchste Form der japanischen Küche
Titelfoto © Baisaoh by Ito Jakuchu, gemeinfrei, Wikimedia Commons
Passende Artikel
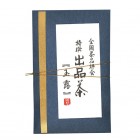
Gyokuro Shuppin, 25 g (preisgekrönter Tee)
Dieser Gyokuro ist im wahrsten Sinn des Wortes ein ausgezeichneter grüner Tee. Regelmäßig wird in Japan die „nationale Tee-Leistungsschau“ (全国茶品評会) abgehalten. Teeproduzenten aus dem ganzen Land reichen ihre besten Produkte ein, um von der Jury aus Teemeistern und Tee-Experten eine der begehrten Auszeichnungen verliehen zu bekommen. Dieser Gyokuro aus Yame (Kyushu) hat es geschafft, in der...
71,00 € *
Inhalt: 25 Gramm (284,00 € * / 100 Gramm)

Teedose 'Nami & Hana' 8,4 x 8,7 cm für 150 g Tee
Die Teedose hat ein Fassungsvermögen für 150g Matcha-Tee. Bei Bestellung erhalten Sie eine der Dosen - eine Farbwahl ist leider nicht möglich.
14,00 € *
Inhalt: 1

Gusseisernes Tee Set - Arare 0,9 L
Das Modell Arare gehört zu den beliebtesten Vertretern der gusseisernen Teekannen. Das klassische Nagelkopfdesign symbolisiert den asiatischen Minimalismus und ist ein Muss für alle Liebhaber der asiatischen Teekultur.
ab 79,00 € *
Inhalt: 1

Japanwelt Wundertüte "Fukubukuro" - Tee
Fukubukuro – die japanischen Glückstüten oder Lucky Bags mit Tees, Teezubehör oder Teegeschirr . Sie kennen zwar nicht genau den Inhalt der Wundertüte, können sich aber sicher sein, dass der eigentliche Warenwert den von Ihnen gezahlten Kaufpreis übersteigt. Machen Sie sich selbst eine Freude und beschenken sich mit einer japanischen Lucky Bag. Die freudige Erwartung beim Öffnen der Tasche und die...
Statt: 99,50 € * ab 24,50 € *
Kommentar schreiben