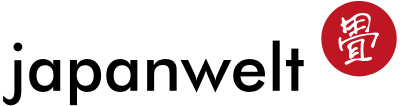Fuku & Batsu in Japan: Die Bedeutung von Glück (福) und Pech (罰) im Alltag
In Japan ist die Welt nicht klar in Schwarz und Weiß geteilt. Vielmehr leben Glück und Pech, Licht und Schatten, als kulturelle Gegenspieler nebeneinander. Zwei Kanji stehen dabei sinnbildlich für diese Gegensätze: 福 (Fuku) für Glück und Wohlstand, 罰 (Batsu) für Strafe, Pech und Fehltritt. Diese Zeichen begegnen Ihnen in Japan nicht nur in Tempeln, auf Schildern, sondern auch in Spielen, auf Verpackungen und im täglichen Sprachgebrauch.
Die Vorstellung von Glück (Fuku) ist dabei tief in religiösen Traditionen, jahreszeitlichen Ritualen und gesellschaftlichen Werten verwurzelt. Pech (Batsu) hingegen bedeutet nicht nur Unglück im westlichen Sinne, sondern verweist oft auf Disharmonie, schlechtes Karma oder Regelverstöße. Doch was bedeuten diese Zeichen im Alltag wirklich? Welche Rituale, Bräuche und Symbole begleiten sie? Und wie gehen die Japaner mit Glück und Pech um?

-
Moderne Glücksbringer in Japan: Ema-Tafeln im Anime Stil im Kanda Myōjin (Kanda Schrein) in Tokyo. Foto © Susann Schuster auf Unsplash
Glücksbringer in Japan: Symbole für Schutz, Hoffnung und Harmonie
In Japan begegnen uns Glücksbringer auf Schritt und Tritt – an Schultaschen, in Taxis, vor Haustüren. Viele sind klein, unscheinbar, doch sie tragen große Bedeutungen.
Ziehen Sie Ihr virtuelles Omikuji – Glückslos ????
Was gilt in Japan als Glücksbringer?
Japan kennt eine beeindruckende Vielfalt an Glücksbringern, die Sie vor allem an Neujahr, bei Schulanfängen, Prüfungen, Geschäftsabschlüssen oder Hochzeiten antreffen. Besonders verbreitet sind:
- Omamori (お守り): Schutzamulett aus Stoff, meist an Schreinen oder Tempeln erhältlich. Jeder Omamori hat eine spezielle Bedeutung – für Gesundheit, Erfolg, Verkehrssicherheit, Liebe, Geburten a.
- Maneki-neko (招き猫): Die winkende Katze, die Kundschaft, Glück oder Geld anlocken soll. Je nach Pfote und Farbe unterscheiden sich Bedeutung und Einsatzort – eine erhobene rechte Pfote bringt Glück im Geld, die linke lockt Gäste. Original japanische Maneki-Neko bei Japanwelt
- Daruma (達磨): Eine runde Figur ohne Augen, die für Zielstrebigkeit Man malt das erste Auge beim Wünschen, das zweite bei Erfüllung. Basierend auf dem buddhistischen Mönch Bodhidharma steht er auch für Durchhaltevermögen. Handgefertigte Daruma bei Japanwelt
- Ema (絵馬): Holztafeln, auf die Wünsche geschrieben werden. Sie werden in Tempeln aufgehängt, damit die Gottheiten sie lesen können. Besonders häufig in Prüfungszeiten.
- Kin no unko (金のうんこ): Der "goldene Haufen" – ein modernes, humorvolles Glückssymbol, das vor allem bei jungen Menschen beliebt ist. Es kombiniert das japanische Wortspiel zwischen "Unko" (Kackhaufen) und "un" (Glück) und wird auf Bleistiften, Aufklebern oder sogar als Schlüsselanhänger verkauft.
Der japanischen Religionswissenschaftlerin Dr. Noriko Kanda zufolgen: „werden Glücksbringer wie Omamori oder Maneki-neko nicht als Aberglauben gesehen, sondern als Mittel, die eigene Intention zu stärken. Sie erinnern uns daran, wofür wir dankbar sein wollen.“

- Glück und Pech haben in Japan viele Gesichter – von kraftvollen Schrift-zeichen über Maskenrituale bis hin zu symbolischen Gegenständen des Alltags. Foto © Roméo A. auf Unsplash
Das Kanji 福 (Glück) im Alltag
Das Zeichen für Glück – 福 – begegnet Ihnen in Japan häufig: auf Neujahrskarten, an Hauseingängen, in Restaurantnamen, auf Fukubukuro-Tüten oder sogar auf Verpackungen von Lebensmitteln. Besonders zum Neujahrsfest wird das Zeichen – häufig auf rotem Papier gedruckt – mit großer Sorgfalt geschrieben oder aufgehängt. Es soll Glück ins Haus bringen.
Wörtlich bedeutet 福 Glück, Segen und Wohlstand. Das Zeichen setzt sich aus 礻 (der stilisierten Darstellung eines Altars oder göttlichen Zeichens) und 畐 (ursprünglich ein Gefäß, das mit Wein oder Getreide gefüllt ist) zusammen – also sinnbildlich: „ein von den Göttern gefülltes Leben“.
Ein faszinierender Brauch: In China und teilweise auch in Japan wird das Zeichen manchmal auf dem Kopf stehend aufgehängt. Der Grund: Das chinesische Wort für "umgekehrt" (dao) klingt wie das Wort für "ankommen" – das Glück kommt also "an". In Japan ist dieser Brauch vor allem in designaffinen Haushalten in urbanen Zentren wie Tokyo oder Osaka beliebt.
Moderne Glücksbringer
Neben den klassischen Glücksbringern sind auch moderne Varianten verbreitet. Besonders beliebt bei Jugendlichen sind kleine Handy-Anhänger mit Glückssymbolen, günstige Mini-Omamori, trendige Charms, Sticker oder eben der oben erwähnte "Kin no unko".
Auch digitale Glücksbringer wie App-basierte Horoskope und virtuelle Omikuji auf Tempel-Webseiten haben an Beliebtheit gewonnen.
Fuku-Feste: Rituale und Bräuche rund ums Glück
Viele japanische Feste und Bräuche drehen sich darum, das Glück ins Haus zu holen – oft mit einem Augenzwinkern, manchmal mit tiefer spiritueller Bedeutung. Drei der bekanntesten Rituale stellen wir Ihnen hier vor.
Setsubun: Wenn das Glück gerufen wird
Beim Setsubun-Fest im Februar wird der Winter ausgetrieben und das Glück eingeladen. Familien rufen "Oni wa soto! Fuku wa uchi!" („Dämonen raus! Glück rein!") und werfen geröstete Sojabohnen, um das Haus von Unglück zu befreien. Oft trägt ein Familienmitglied eine Oni-Maske – eine humorvolle, doch tief verwurzelte Darstellung des Bösen.

-
Date Masamune Kostümierung auf dem Setsubun-Festival im Shiogama-jinja-Tempel
Foto © Eraevsky, Сэцубун в храме Сиогама-дзиндзя (5) 2020, CC BY-SA 4.0
Fukuwarai: Das Lachen als Glücksbringer
Ein typisches Neujahrsspiel ist Fukuwarai (福笑い). Dabei werden einem Gesicht (aus Papier) blind Augen, Mund und Nase zugeordnet. Das oft komische Ergebnis lässt alle lachen – und Lachen bringt Glück. Der Name selbst bedeutet übersetzt "Glückslachen". Es wird vor allem in Kindergärten, Schulen oder in Familien gespielt.
Fukubukuro: Die Tüte voller Glück
Die Fukubukuro (福袋) ist eine "Glückstüte", die Anfang Januar in vielen Geschäften verkauft wird. Der Inhalt ist meist überraschend, aber günstig. Der Brauch steht für das Glück des Neuanfangs und ist bei jungen Leuten ebenso beliebt wie bei älteren Schnäppchenjägern. Große Kaufhäuser locken mit exklusiven Editionen, manche Läden geben Hinweise auf den Inhalt – andere setzen auf vollständige Überraschung.
Der Soziologe Professor Hiroshi Taniguchi hierzu: „Fukubukuro ist mehr als ein Verkaufsevent – es repräsentiert die Erwartung, dass das neue Jahr Positives bereithält. Es ist der materielle Ausdruck von Hoffnung.“
Individuelle Fukubukuro sind auch im Sortiment von ➤ Japanwelt erhältlich.
Pech im Alltag: Die Symbolik von 罰 (Batsu)
Wo Glück bewusst eingeladen wird, wird Pech nicht ignoriert – sondern benannt, markiert, manchmal sogar inszeniert. Das Kanji 罰 steht dabei im Zentrum einer Kultur des achtsamen Umgangs mit Fehlern und Folgen.
Das Kanji 罰 – mehr als nur Strafe
Das Schriftzeichen 罰 steht für Strafe, Sühne, aber auch im weiteren Sinne für Unglück als Konsequenz falschen Verhaltens. Es wird oft verwendet in Begriffen wie "batsu-game" oder "bachi ga ataru" – was bedeutet, dass jemand karmische Strafe erfährt.
Der moralische Kontext ist entscheidend: Pech ist oft nicht zufällig, sondern hat Ursachen, die auf Verhalten, Unachtsamkeit oder Missachtung zurückzuführen sind.
Das Kanji 罰 steht also für eine Konsequenz, die aus falschem Verhalten, Verstoß gegen Regeln oder moralischem Fehltritt erwächst – oft im Sinn einer gerechten Strafe oder eines karmischen Ausgleichs.
Batsu-Games: Wenn Strafe zur Unterhaltung wird
In der japanischen Popkultur gibt es sogenannte Batsu Games (罰ゲーム), bei denen Verlierer einer Aufgabe eine mehr oder weniger peinliche Strafe erhalten – z. B. ein scharfes Wasabi-Sushi essen, in ein Eisbad steigen oder ein Lied singen.
Diese Games sind in Fernsehshows wie "Downtown no Gaki no Tsukai ya Arahende!!" populär und zeigen, wie locker man mit dem Konzept des "kleinen Pechs" umgehen kann. Auch auf YouTube oder TikTok erfreuen sich „Batsu Challenges“ großer Beliebtheit.
Pech visuell dargestellt: X
Die Symbolik des Batsu-Zeichens (×) ist in Japan tief im Alltag verankert. Es steht für „Nein“, „falsch“ oder „nicht erlaubt“ – und wird überall dort eingesetzt, wo etwas abgelehnt oder korrigiert werden soll.
In Quiz-Shows bedeutet ein rotes X eine falsche Antwort, auf Verkehrsschildern warnt es vor Verboten, auf Prüfungsbögen markiert es Fehler. Auch in Videospielen, Apps und Chats zeigt das Batsu, wenn etwas nicht geklappt hat.
So dient es als visuelles Zeichen, das ohne Worte deutlich macht: Hier ist etwas schiefgelaufen oder nicht erwünscht.

- Ein rotes X signalisiert im japanischen Alltag klar: Hier ist kein Durchkommen – das universelle Zeichen für Fehler, Verbot oder Pech im urbanen Raum. Foto © nakashi - Flickr, CC BY-SA 2.0
Glücks- und Pechzahlen in Japan
Zahlen tragen in Japan Bedeutungen, die weit über das Zählen hinausgehen.
Drei, sieben und acht gelten als positiv – die Drei steht für Balance, die Sieben erinnert an die Glücksgötter, die Acht an Ausdehnung und Wachstum.
Vier und neun dagegen lösen Unbehagen aus: Ihre Aussprache ähnelt den Wörtern für Tod (shi) und Leiden (ku). Deshalb fehlen sie oft auf Zimmernummern oder Geschenkverpackungen – nicht aus Aberglaube, sondern aus Rücksicht.
Sternzeichen und Schicksal im japanischen Denken
Die 12 Tierkreiszeichen (Jūnishi) folgen einem zwölfjährigen Zyklus und prägen in Japan nicht nur den Kalender, sondern auch Vorstellungen von Persönlichkeit, Schicksal und Lebensphasen.
Jedem Jahr ist ein Tier zugeordnet – vom Drachen über das Pferd bis hin zur Ratte –, und viele Menschen glauben, dass das Geburtszeichen Einfluss auf Charakter, Glück und zwischenmenschliche Beziehungen hat.
Einige Tiere gelten traditionell als besonders günstig, etwa der Drache oder das Pferd, während andere – wie das Wildschwein – je nach Kontext ambivalenter gesehen werden. Horoskope, Neujahrsbräuche und sogar Wahl des Hochzeitstermins orientieren sich nicht selten an diesem Tierkreis.
Was bedeutet Glück für Japaner?
Glück ist in Japan kein Zufall, sondern etwas, das man durch richtige Vorbereitung, Respekt vor Traditionen und Harmonie mit der Umwelt einlädt.
Wie eine Shintō-Priesterin in einem Interview mit der Asahi Shimbun erklärte: „Glück ist wie ein Gast. Wenn das Haus sauber und offen ist, wird er vielleicht eintreten.“
Im Alltag äußert sich Glück oft durch kleine Dinge: ein erfolgreicher Schulabschluss, eine sichere Heimkehr oder ein gutes Geschäftsjahr.
Diese Momente werden häufig bewusst wahrgenommen und mit Dankbarkeit gefeiert – etwa durch den Kauf eines neuen Omamori oder das Aufhängen einer Ema-Tafel. Auch Rituale wie tägliche Dankgebete, Reinigungsrituale oder das Tragen symbolischer Farben (z. B. Rot für Schutz) gehören zur Praxis.
Zwischen 福 und 罰 – Wie Glück und Pech das Denken in Japan prägen
In Japan existieren Glück und Pech nicht als isolierte Extreme, sondern als Teil eines ausgewogenen Lebenskonzepts. Rituale, Schriftzeichen, Spiele, Redewendungen und Bräuche helfen dabei, diese Kräfte zu erkennen, zu lenken und mit ihnen im Einklang zu leben.
Vielleicht entdecken auch Sie beim nächsten Besuch eines japanischen Schreins ein kleines Zeichen fürs Glück – oder erkennen im Pechmoment ein Lächeln. Denn Glück, so sagen die Japaner, beginnt oft dort, wo man es bewusst wahrnimmt.
Das könnte Sie auch interessieren:
Ikigai oder das Glück im Alltag – mehr Sinn im Leben finden
Shichi Fukujin – die sieben Glücksgötter Japans
Welche Bedeutung haben Tiere in Japan? Mythologie und Symbolik
Titelfoto © Clark Gu auf Unsplash
Passende Artikel

Glücksbringer 'Winkekatze'
Glücksbringer Winkekatze in verschiedenen Farben mit einer Größe von etwa 3 cm. Farbwünsche können bedingt berücksichtigt werden. Japanische Glücksbringer, auch Engimono genannt, sind tief in der japanischen Kultur verwurzelt. Diese „Charaktere“ haben sich aus Legenden und Erzählungen aber auch aus den beiden Religionen Buddhismus und Shintoismus herausgebildet. Neben den chinesischen Tierkreiszeichen, die sich in der Regel jedes Jahr im...
9,00 € *

Rollbild Glück - 19 cm Breite
Chinesisches Rollbild mit Kalligrafie-Motiv: „ Glück “. Schwarze Tuschezeichnung auf rotem Grund. Das Papierroll-Bild hat eine stoffähnliche Umrahmung der roten Fläche in Weiß. Oben und unten wird das Bild abgeschlossen mit einem stoffähnlichen Material in Grün/Blau. Die Aufhängung oben erfolgt über ein Samtband, mit welchem die Rolle in geschlossenem Zustand zugebunden werden kann.
16,50 € *
Inhalt: 1 Stück

MEISAN Daruma 9 cm
Diese Daruma stammen aus der Region Takasaki in der Präfektur Gunma. Diese Region ist traditionell bekannt für seine vielen Meisterbetriebe und Manufakturen, die sich der Herstellung echter japanischer Daruma verschrieben haben. MEISAN (jap. für "Spezialität, berühmtes Produkt") Daruma sind daher unsere besonderen Glücksbringer direkt aus der Manufaktur. Alle Daruma sind mit Liebe und Tradition hergestellt und...
12,00 € *
Inhalt: 1

Glücks-Katze, Lavaguß
Katze, aus Lavaguss, antikfinish, 2 verschiedene Größen Aus Lavastein gegossen und mit einem Antikfinish veredelt. Bei dieser Herstellung handelt es sich um ein nasses Gußverfahren. Es wird mit mehr Wasser gearbeitet, als bei Formstein-Varianten. Dadurch entsteht eine glattere Oberfläche. Auch diese Figuren sind frostfest. Bei diesem Artikel handelt es sich um ein Naturprodukt. Leichte Abweichungen in Form, Farbe,...
ab 89,00 € *
Inhalt: 1

Glücksbringer - Ninja
Japanische Glücksbringer helfen Ihnen bei der Erfüllung Ihrer Wünsche – oder sind das ideale Geschenk für Japan Fans. Die kleinen Glücksbringer - Ninja sind nicht nur niedlich anzusehen, sie bringen als Stehaufmännchen ihrem Besitzer auch Glück . Dabei haben die Okiagari-koboshi genannten japanischen Glücksbringer eine lange Tradition. Schon im 14. Jahrhundert werden sie als japanisches...
9,00 € *
Inhalt: 1
Kommentar schreiben