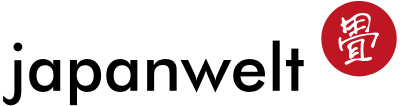Tod durch Überarbeitung: Warum Karōshi in Japan so verbreitet ist
Japan leidet seit langem unter einer Kultur der Überarbeitung – in Extremfällen bis zum Karōshi – dem Tod durch Überarbeitung. Lange Arbeitszeiten, hohe Verantwortung und ständiges Streben nach Perfektion - diese typisch japanische Mentalität hat ihren Preis. Immer mehr Menschen fallen dem sogenannten Karōshi zum Opfer – dem „Tod durch Überarbeitung“. Herzinfarkt, Schlaganfall oder Suizid sind nur einige der erschütternden Folgen. Was genau steckt hinter dem Phänomen Karōshi? Welche Symptome treten auf und wie versucht man in Japan, dieser Entwicklung entgegenzuwirken?
Karōshi ist kein rein umgangssprachlicher Begriff, sondern ein offiziell anerkannter medizinischer Zustand in Japan. Die japanische Regierung hat das Problem erstmals in den 1980er Jahren offiziell untersucht, nachdem die ersten bekannten Todesfälle durch Überarbeitung Schlagzeilen machten.*

-
Nicht nur die schockierend vielen Überstunden belasten die Arbeitnehmer in Japan, hinzu kommen noch lange Pendelwege in die Metropolregionen.
Foto © john crozier auf Unsplash
Was bedeutet Karōshi?
Was heißt Karōshi auf Deutsch?
Der Begriff „Karōshi“ (過労死) bedeutet auf Deutsch „Tod durch Überarbeitung“. Er setzt sich aus den japanischen Wörtern „Karō“ (過労) für „Überarbeitung“ und „Shi“ (死) für „Tod“ zusammen. Der Begriff beschreibt den plötzlichen Tod infolge extremer physischer oder psychischer Belastungen am Arbeitsplatz.
Wie ist der Begriff Karōshi entstanden?
Der Begriff wurde erstmals in den 1970er Jahren in Japan bekannt, als Fälle von plötzlich verstorbenen Arbeitern in den Medien für Aufsehen sorgten. Zu dieser Zeit erlebte Japan einen wirtschaftlichen Aufschwung, was allerdings zu massiven Überstunden, hohem Leistungsdruck und fehlender Freizeit führte. Bereits im Jahr 1987 erkannte die japanische Regierung Karōshi offiziell als gesundheitliches und gesellschaftliches Problem an.
Historische Entwicklung und kultureller Hintergrund von Karōshi
Die Ursachen für Karōshi liegen tief in der japanischen Arbeitskultur verwurzelt:
Lebenslange Anstellung (Shūshin Koyō): In der traditionellen japanischen Arbeitskultur bedeutete die Arbeit nicht nur eine Erwerbstätigkeit, sondern ein lebenslanges Engagement für das Unternehmen. Viele Arbeitnehmer fühlen sich verpflichtet, unzählige Überstunden zu leisten, um ihre Loyalität zu beweisen.
Gruppendenken (Wa): Harmonie innerhalb der Gruppe hat in der japanischen Kultur einen hohen Stellenwert. Mitarbeiter vermeiden es oft, „schwach“ zu wirken oder durch Beschwerden aufzufallen. Das für allerdings dazu, dass Überstunden in Japans Arbeitskultur als selbstverständlich betrachtet werden.
Wirtschaftswunder und Leistungsdruck: In der Nachkriegszeit war Japan auf wirtschaftlichen Erfolg angewiesen. Die hohen Anforderungen führten zu einem extremen Arbeitsdruck, der bis heute in vielen Branchen anhält.
Karōshi ist damit nicht nur ein medizinisches Phänomen, sondern auch ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Erwartungen, die von Japanern oft mehr verlangen, als sie leisten können.
Der Teufelskreis der Überarbeitung in Japan
Aus diesen Gründen geraten viele Arbeitnehmer in Japan in eine gefährliche Spirale: extreme Arbeitszeiten, sozialer Druck, zu wenig Schlaf und fehlende Erholung verstärken den Zwang, immer mehr zu leisten – bis Körper und Geist versagen. Dieser Kreislauf ist schwer zu durchbrechen, da die japanische Mentalität und Tradition genau diese Strukturen stützen.
In der japanischen Arbeitskultur sind Arbeit und sozialer Status eng verknüpft. Ein erfolgreiches Berufsleben gilt als Pflicht gegenüber Familie, Firma und Gesellschaft.
Ein typischer Arbeitstag in Japan beginnt zwischen 8 und 9 Uhr morgens und endet oft erst spät am Abend. Pausen sind kurz oder entfallen ganz, da oft am Schreibtisch gegessen wird. Nach Feierabend sind gemeinsame Trinkgelage bis in die Nacht, die berüchtigten Nomikai (Trinkgelage) noch immer üblich, ein enormer Gruppenzwang unter Kollegen und Vorgesetzten.
Hinzu kommt noch das tägliche Pendeln von bis zu zwei Stunden, viele Japaner können sich die extrem hohen Preise in den Innenstädten nicht leisten.
Offiziell liegt die gesetzliche Wochenarbeitszeit bei 40 Stunden, aber in der Realität arbeiten viele über 10 bis 12 Stunden am Tag. Besonders in Branchen wie IT oder Produktion sind solche Arbeitszeiten die Norm. Über 20 Prozent der Arbeitnehmer leisten regelmäßig mehr als 80 Überstunden im Monat – eine gefährliche Schwelle zum Karōshi.
Karōshi-Symptome und Warnzeichen
Ein Karōshi-Tod (過労死) tritt plötzlich auf und wird durch Überarbeitung verursacht, meist in Form eines Herzinfarkts, Schlaganfalls oder Suizids. Die gesundheitlichen Auswirkungen entstehen schleichend, bis der Körper kollabiert. Doch es gibt oft Warnsignale, die ignoriert werden.
Karōshi erfolgt in mehreren Stufen durch chronischen Stress und Übermüdung:
- Anhaltender Stress und Schlafmangel: Dauerhafte Überstunden führen zu einem ständigen „Kampf-oder-Flucht“-Modus des Körpers. Der Cortisolspiegel steigt, Herzfrequenz und Blutdruck erhöhen sich.
- Erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen: Der Körper gerät in ein Ungleichgewicht, was zu Bluthochdruck, Entzündungen in den Blutgefäßen und schließlich Herzinfarkt oder Schlaganfall führen kann.
- Mentale Überlastung: Psychischer Druck erhöht das Risiko für Depressionen, Angstzustände und Burnout, was in schweren Fällen zu Suizid führen kann.
Körperliche und mentale Warnsignale vor einem Karōshi-Tod
Körperliche Warnzeichen:
- Chronische Erschöpfung: Selbst nach ausreichend Schlaf fühlen Sie sich ständig müde.
- Starke Kopfschmerzen oder Migräne: Ein Zeichen für erhöhten Blutdruck und Stress.
- Schmerzen in der Brust: Ein mögliches Anzeichen für Herzprobleme.
- Atemnot oder Herzklopfen: Der Körper signalisiert Überlastung.
- Magen-Darm-Beschwerden: Chronischer Stress schlägt oft auf den Magen und führt zu Verdauungsproblemen.
Mentale Warnzeichen:
- Anhaltende Gereiztheit oder Wutausbrüche
- Konzentrationsprobleme oder „Blackouts“
- Gefühl der Überforderung
- Schlafstörungen oder Schlaflosigkeit
- Gefühl der Hoffnungslosigkeit oder Depression
Warum werden Karoshi-Symptome oft ignoriert?
Die Symptome, die auf einen drohenden Karōshi-Tod hinweisen, werden in der Tat von den Betroffenen häufig ignoriert. Das hat in Japan verschiedene gesellschaftliche und kulturelle Ursachen.
Zum einen spielt der kulturelle Druck eine zentrale Rolle, da die japanische Arbeitskultur Überstunden als selbstverständlich ansieht. Viele Mitarbeiter fürchten, als schwach oder unzuverlässig zu gelten, wenn sie ihre Grenzen aufzeigen.
Hinzu kommt, dass sich viele Menschen an den chronischen Stress gewöhnt haben. Er wird als normaler Teil des Alltags betrachtet, sodass Warnzeichen oft nicht ernst genommen werden.
Ein weiterer Grund liegt in der fehlenden Erholung: Wer ständig arbeitet und kaum Pausen macht, hat wenig Zeit, seinen körperlichen Zustand bewusst wahrzunehmen. Zudem suchen viele Betroffene erst dann medizinische Hilfe, wenn es bereits zu spät ist. Regelmäßige Untersuchungen sind schon aufgrund der Arbeitsbelastung kaum zu organisieren.
Statistiken und aktuelle Situation in Japan: Wie verbreitet ist Karōshi?
Karōshi bleibt in Japan ein ernstes Problem. Offizielle Statistiken und Schätzungen zeigen die Verbreitung dieses Phänomens.
Im Jahr 2023 wurden in Japan 2.968 Todesfälle durch arbeitsbedingte Probleme verzeichnet. Diese Zahl umfasst sowohl physische Ursachen wie Herzinfarkte und Schlaganfälle als auch psychische Belastungen, die zu Suizid führen können.
Ein Weißbuch der japanischen Regierung aus dem Jahr 2024 berichtete von 883 anerkannten Fällen von arbeitsbedingten psychischen Erkrankungen, was einen Anstieg von 173 Fällen gegenüber dem Vorjahr darstellt und den höchsten bisher verzeichneten Wert markiert. Unter diesen Fällen gab es 79 Suizide oder Suizidversuche. Zudem wurden 216 Personen mit arbeitsbedingten Hirn- oder Herzerkrankungen anerkannt, was erstmals seit vier Jahren wieder über 200 liegt.
Trotz Bemühungen der Regierung und von Unternehmen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern und Überarbeitung zu reduzieren, bleibt die Zahl der Karōshi-Fälle hoch. Die COVID-19-Pandemie hat die Situation möglicherweise weiter verschärft, da sie zusätzliche Stressfaktoren für Arbeitnehmer mit sich brachte.
Regionale Unterschiede und besonders gefährdete Berufe
Bestimmte Branchen und Berufe sind besonders anfällig für Karōshi. Dazu gehören das Transportwesen, die Bauindustrie und das Gesundheitswesen, in denen lange Arbeitszeiten und hoher Stress häufig sind.
Die Verbreitung von Karōshi zeigt in Japan auch regionale Unterschiede, die auf die unterschiedlichen wirtschaftlichen Bedingungen und Arbeitskulturen in den Präfekturen zurückzuführen sind. In städtischen Regionen wie Tokio oder Osaka, wo der wirtschaftliche Druck hoch ist und viele Menschen in der Dienstleistungsbranche oder im Büro arbeiten, treten häufig Fälle von Überarbeitung auf.
Auch lange Pendelzeiten, hoher Konkurrenzdruck und Überstunden sind in den Metropolregionen besonders verbreitet. Im Gegensatz dazu sind in ländlicheren Präfekturen, in denen mehr Menschen in der Landwirtschaft oder in traditionellen Industrien tätig sind, Karōshi-Fälle seltener.
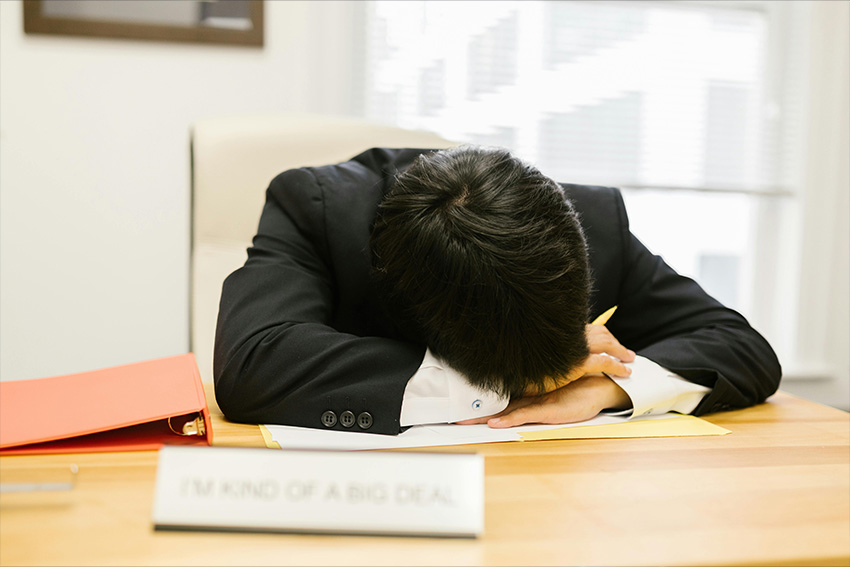
-
Inemuri – der strategische Schlaf - sieht man in Japan überall – am Arbeitsplatz, in der U-Bahn, auf einer Parkbank. Inemuri ist gesellschaftlich durchaus hoch angesehen, zeigt es doch den Einsatz und die Erschöpfung eines Menschen, der sich voll für seine Aufgaben einsetzt.
Foto © RDNE Stock project
Bekannte Karōshi-Fälle in Japan
Einige tragische Fälle von Karōshi erregten auch über Japan hinaus derartiges Aufsehen, dass letztendlich eine längst überfällige gesellschaftliche Debatte über die Arbeitskultur in Japan begann.
Matsuri Takahashi (2015) – Der Fall, der eine Debatte auslöste
Matsuri Takahashi war eine 24-jährige Mitarbeiterin der Werbeagentur Dentsu, einem großen Unternehmen mit berüchtigt langen Arbeitszeiten. Sie nahm sich das Leben, nachdem sie über Monate hinweg mehr als 100 Überstunden pro Monat geleistet hatte. In ihrem letzten Tweet schrieb sie: „Warum muss das Leben so hart sein?“
Ihr Tod führte zur staatlichen Untersuchung des Unternehmens und einer landesweiten Diskussion über das Thema Karōshi. Die Agentur wurde schließlich wegen Missachtung der Arbeitszeitregelungen verurteilt.
Miwa Sado (2013) – Eine Journalistin, die nie zur Ruhe kam
Die 31-jährige Miwa Sado arbeitete als TV-Reporterin beim japanischen Sender NHK. Innerhalb eines Monats absolvierte sie 159 Überstunden und wurde durch die permanente Berichterstattung über politische Themen stark belastet. Kurz nach ihrer letzten Berichterstattung starb sie an einem Herzinfarkt. Der Fall wurde erst Jahre später öffentlich bekannt gemacht und sorgte für erhebliche Kritik.
Kenji Yamamoto (2002) – Der Ingenieur mit 110 Überstunden pro Monat
Kenji Yamamoto war ein 34-jähriger Ingenieur in einem großen japanischen Unternehmen. Über ein Jahr hinweg leistete er monatlich über 110 Überstunden, was ihn gesundheitlich schwer belastete. Er erlitt schließlich einen tödlichen Herzinfarkt direkt nach der Arbeit. Sein Tod wurde erst nach einem langen juristischen Kampf seiner Hinterbleibenden offiziell als Karōshi anerkannt.
Toshio Kawai (1990er-Jahre) – Der erste offiziell anerkannte Fall
Der Begriff „Karōshi“ erlangte durch Toshio Kawai erstmals größere Bekanntheit. Der 54-jährige Manager eines großen Unternehmens starb während eines Meetings an einem Herzinfarkt. Sein Tod wurde als der erste offiziell als Karōshi anerkannte Fall in Japan eingestuft und führte zu verstärkter Berichterstattung über die Arbeitsbedingungen in japanischen Firmen.
Der „Toyota-Fall“ (2007) – Tod eines jungen Mitarbeiters
Ein 30-jähriger Angestellter von Toyota brach nach einem Monat mit über 80 Überstunden tot zusammen. Die Familie des Mannes verklagte das Unternehmen, woraufhin die japanische Arbeitsbehörde seinen Tod als Karōshi-Fall anerkannte.
Dieser Fall sorgte international für Schlagzeilen und setzte Toyota unter erheblichen öffentlichen Druck, seine Arbeitszeitregelungen anzupassen.
Karōshi gibt es nicht nur in Japan
Während Japan für den Begriff Karoshi bekannt ist, wurde auch in Ländern wie Südkorea, China und den USA Fälle von Tod durch Überarbeitung dokumentiert. In Südkorea spricht man von "Gwarosa", und in China sorgt die sogenannte "996-Kultur" (9 bis 9 Uhr, 6 Tage die Woche) für zunehmende Fälle von Erschöpfung und gesundheitlichen Problemen.
Auch in westlichen Ländern, etwa in der US-Technologie- und Finanzbranche, gibt es Berichte über Überarbeitung. Andere Länder, darunter Deutschland, diskutieren zwar über ähnliche Problematiken, jedoch ohne einen etablierten Begriff wie Karōshi.
Die Reaktionen von Politik und Gesellschaft zu Karōshi
Die japanische Regierung hat auf das Problem Karōshi mit verschiedenen Maßnahmen reagiert. Seit den 1980er Jahren wurden Kampagnen zur Sensibilisierung gestartet und 2014 das „Karōshi-Gesetz“ eingeführt, das Vorbeugung, Aufklärung und Untersuchungen umfasst. Zudem gibt es ein nationales System zur Erfassung von Überarbeitungsfällen, um besser gegensteuern zu können.
Ein Meilenstein war 2019 die Verabschiedung des „Work Style Reform Law“, das Überstunden auf 45 Stunden pro Monat und 360 Stunden pro Jahr begrenzt. Für bestimmte Branchen gelten allerdings Ausnahmen.
Zusätzlich werden flexible Arbeitsmodelle wie Teilzeit und Homeoffice gefördert. Unternehmen müssen zudem regelmäßige Gesundheitschecks und Programme zur psychischen Gesundheit anbieten, um Risiken frühzeitig zu erkennen.
Die Reaktionen der Unternehmen und Gewerkschaften sind unterschiedlich. Große Konzerne wie Toyota haben interne Maßnahmen ergriffen, um Überstunden zu reduzieren. Kleinere Firmen hingegen befürchten Produktivitätseinbußen. Gewerkschaften begrüßen die Reformen und fordern strengere Kontrollen, um sicherzustellen, dass die neuen Gesetze flächendeckend eingehalten werden.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu Karōshi
Was heißt Karōshi auf Deutsch?
Karōshi bedeutet „Tod durch Überarbeitung“ und beschreibt gesundheitliche Schäden oder Todesfälle, die durch übermäßige Arbeitsbelastung entstehen.
Wie viele Stunden am Tag arbeiten Japaner?
Obwohl die gesetzliche Arbeitszeit 8 Stunden täglich beträgt, sind Überstunden weit verbreitet. Viele Arbeitnehmer arbeiten 10 bis 12 Stunden pro Tag, vor allem in belastenden Branchen.
Was verursacht Karōshi?
Die Hauptursachen sind chronische Überstunden, Schlafmangel, psychischer Stress und fehlende Erholung. Auch sozialer Druck spielt eine große Rolle, da viele Angestellte aus Angst vor Karriereeinbußen lange arbeiten.
Was sind typische Karōshi-Symptome?
Zu den Symptomen gehören körperliche Erschöpfung, Herz-Kreislauf-Probleme, chronischer Stress, Schlafstörungen und psychische Beschwerden wie Depressionen oder Burnout. In schweren Fällen führen sie zu Herzinfarkten oder Schlaganfällen.
*Dieser Text beschreibt die gesellschaftliche Problematik des Karoshi, Todesfälle durch Überarbeitung bis hin zum Suizid. Der Text ist rein informativ und will keinen Anreiz für Nachahmung geben. Wenn Sie selbst depressiv sind, wenn sie Suizid-Gedanken plagen, dann kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge über die kostenlosen Hotlines 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 oder 116 123. Die Deutsche Depressionshilfe ist in der Woche tagsüber unter 0800 / 33 44 533 zu erreichen.
Das könnte Sie auch interessieren:
Jōhatsu – Warum Menschen in Japan freiwillig verschwinden
Verbote, wichtige Regeln und Gesetze, die man in Japan kennen sollte
Die 15 wichtigsten Verhaltensregeln für Japan
Titelfoto © Mikhail Nilov
Passende Artikel

Japanwelt Wundertüte "Fukubukuro" - Japan
Fukubukuro mit Thema Japan stehen für verschiedene Artikel aus dem Japanwelt-Sortiment. Sie erhalten ein gemischtes Set von japanischen Artikeln. Moderne und Tradition werden in den Glückstaschen vereint. Sie wissen zwar nicht, welche Artikel aus dem Japanwelt-Sortiment wirklich enthalten sind, Sie werden aber ein Schnäppchen machen. Der Warenwert der Lucky Bag übersteigt den Kaufpreis deutlich. Seit Beginn des 20....
Statt: 25,00 € * ab 20,00 € *
Inhalt: 9.0000

monbento Square 1,7 l - Die quadratische Bento Box Schwarz
Die monbento Square ist fast doppelt so groß wie die monbento Original und ist für den großen Hunger. Sie ist höher, so dass jedes Fach für bunte Salate und üppige belegte Brote geeignet ist. Auch ideal für das Familien-Picknick geeignet! Praktisch: Die Bento-Box Square beinhaltet eine separate Form, um Ihr Essen zu trennen und 2 unterschiedlich lange Gummibänder, für den Transport von einer...
ab 29,90 € *
Inhalt: 1.0000

Samurai Regenschirm
Jeder Samurai braucht ein Schwert und einen Regenschirm! Warum nicht beides gleichzeitig haben? Der Samurai-Regenschirm ist ein lustiges kleines Gimmick für Japan- und Cosplay-Fans. Es handelt sich dabei um einen relativ großen Regenschirm mit einem Durchmesser von 100cm im ausgebreiten Zustand. Herzstück des schwarzen Schirms ist der lange Griff, welches aus Kunststoff ist, aber die Form eines Samurai-Schwertes nachahmt....
ab 23,00 € *
Inhalt: 1 Stück
Kommentar schreiben