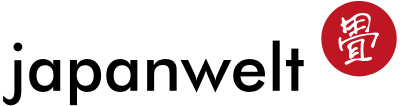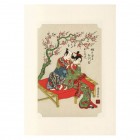Gagaku: Die traditionelle Hofmusik Japans
Gagaku (雅楽) bedeutet übersetzt „elegante Musik“ und ist der älteste überlieferte japanische Musikstil. Dieser wird seit dem 7. Jahrhundert nachweislich als höfische Musik am japanischen Kaiserhaus gespielt. Teile der zur Gagaku gehörenden Musik sind sogar noch älter. Der ursprünglich aus China übernommene und dann angepasste Musikstil besteht aus Kammermusik, Chor und Orchestermusik und beinhaltet auch Tanzdarbietungen. Diese spezielle Form der japanischen Musik hat zudem einen kultischen Aspekt, insbesondere im Shintō-Glauben. Seit 2009 gehört Gagaku, nach der Aufnahme in die UNESCO-Liste, offiziell zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit.
Was ist Gagaku?
Die „elegante Musik“ Gagaku wird seit dem 7. Jahrhundert als Hofmusik am japanischen Kaiserhaus gespielt. Ihren Ursprung hat diese Form der traditionellen Musik größtenteils in der aus China stammenden Yayue-Musiktradition (Gagaku ist die sino-japanische Lesung der Kanji). Erstmals wird diese Musiktradition in den Analekten des Konfuzius aus dem 5. Jahrhundert vor Christus erwähnt. Neben China hatte auch Korea einen großen Einfluss auf diese und andere japanische Musikformen, da der kulturelle Austausch zwischen beiden Ländern zeitweise intensiv war. Musiker und ganze Orchester wurden nach Japan geholt, um die Musik weiterzuentwickeln.
Gagaku umfasst mehrere Komponenten:
- Kangen (管弦): Ensemblemusik
- Saibara (催馬楽) und Rōei (朗詠): Zwei Gesangsformen
- Bugaku (舞楽): Spezielle Tänze
In der Musiktheorie sind insgesamt 28 Tonarten definiert. In der Praxis werden jedoch meist nur sechs Tonarten gespielt. Das heute existierende Repertoire umfasst rund 90 Musikstücke. Einstmals gab es vermutlich deutlich mehr, doch viele Stücke gingen während Perioden des kulturellen Wandels verloren, in denen Gagaku an Popularität einbüßte.
Gagaku unterscheidet sich von der Musik des Nō-Theaters (能) und des Kabuki -Theaters (歌舞伎 „Gesang und Tanz“) schon durch den Umfang der Ensembles. Die beim Gagaku verwendeten Gruppen sind meist größer und vielfältiger. Zudem ist Gagaku keine Begleitmusik, die eine Handlung untermalt, wie es bei Nō oder Kabuki der Fall ist. Vielmehr steht die Musik für sich und wird gelegentlich von Tanzdarbietungen begleitet. Überschneidungen gibt es jedoch in der Tonalität und Rhythmik dieser klassischen japanischen Musikstile.
Die Geschichte von Gagaku
Gagaku trat im 7. Jahrhundert in Japan als eigenständige Musikform auf. Zuvor wurde bereits durch das Yayue, die chinesische Musiktradition, beeinflusste Musik aus Korea am japanischen Kaiserhof gespielt. Ein besonderer Teil des Gagaku ist die Kagura (神楽) genannte Ritualmusik des Shintō, deren Ursprung autochthon japanisch ist und auf die Yayoi-Zeit (ca. 300 v. Chr. bis 300 n. Chr.) zurückgeht. Archäologische Funde belegen, dass Kagura in seiner Frühform bereits während dieser Epoche entstanden sein könnte.
Seine Blütezeit hatte Gagaku als höfische Musik am Kaiserhaus vor allem während der Nara- und Heian-Zeit (etwa 710 bis 1192). In dieser Zeit wurde der Musikstil zunehmend japanisiert und in feste Strukturen gegossen. Zudem entstand ein Musikerbeamtentum, das sich aus den größten Familien in Kyoto, Nara und Osaka rekrutierte. Dieses Musikerbeamtentum besteht durch Adoptionen talentierter Musiker teilweise bis heute fort.
In den folgenden Epochen verlor Gagaku allmählich an Bedeutung. Bereits während der Kamakura-Zeit (ca. 1185 bis 1333) begann der Niedergang. Der Verfall der aristokratischen Hofkultur führte dazu, dass die Aufführung von Gagaku-Musik fast ausschließlich auf den Kaiserhof beschränkt wurde. Zudem isolierten sich die Musikersippen, was die Entwicklung der Musik weiter hemmte.
Den Tiefpunkt erreichte Gagaku während der Muromachi-Zeit (1333 bis 1573), als neue Kunstformen wie das Nō-Theater an Bedeutung gewannen und Gagaku in den Hintergrund drängten. Ein Wiederaufleben begann erst unter Toyotomi Hideyoshi (1536 bis 1598), der ein Gagaku-Orchester unterhielt und die Musiker mit feudalen Lehen ausstattete. Dies ermöglichte es den Musikern, sich voll auf ihre Kunst zu konzentrieren.
Während der Edo-Zeit (1603 bis 1868) setzte sich diese Wiederbelebung fort. Öffentliche Aufführungen blieben jedoch selten. Erst mit den Reformen der Meiji-Restauration (1868 bis 1890) wurde Gagaku einem breiteren Publikum zugänglich gemacht. Ab 1873 konnten auch Nicht-Adelige Musikunterricht nehmen und die Kunst des Gagaku erlernen. Gleichzeitig wurde das Erlernen eines westlichen Musikinstruments für Musiker des Kaiserhofs obligatorisch. Dadurch führen diese Musiker heute neben Gagaku auch westliche klassische Musik auf.
Nach dem 2. Weltkrieg förderte die japanische Regierung die Wiederbelebung dieser traditionellen Musik aktiv. Bis heute gibt es staatliche Förderprogramme, die Mittel bereitstellen, um Gagaku für die Nachwelt zu bewahren. Die Aufnahme von Gagaku in das immaterielle Weltkulturerbe der UNESCO im Jahr 2009 markiert den Höhepunkt dieser Bemühungen und sorgt für zusätzliche Motivation, diese wertvolle Musiktradition weiter zu fördern.
Die Instrumente der Gagaku-Musik
Als höfische und rituelle Musik ist die Gagaku-Musik stark kodifiziert. Dazu gehört ein festes Repertoire an Stücken, bestimmte Manierismen beim Auftreten sowie ein Kanon an Instrumenten. Im Folgenden stellen wir die wichtigsten Instrumente vor, unterteilt in Saiten-, Blas- und Perkussionsinstrumente.
Zu den im Gagaku genutzten Saiteninstrumenten zählen die Biwa (琵琶) oder Gakubiwa, eine kurzhalsige, vierseitige Laute. Es existieren auch fünfsaitige Modelle, die jedoch nicht für die Aufführung von Gagaku-Musik verwendet werden. Ebenfalls bedeutend ist die Koto (箏), eine Zither mit dreizehn Saiten. Im Gagaku wird manchmal auch die Gakuso, der Vorläufer der Koto, gespielt.
Die für Gagaku genutzten traditionellen Blasinstrumente umfassen die Shō (笙), eine Mundorgel mit 17 Bambuspfeifen. Die Hichiriki (篳篥) ist ein kleines Doppelrohrblattinstrument, während die Ryūteki (龍笛, „Drachenflöte“) eine japanische Querflöte aus Bambus ist.

-
Musiker der Ruyteki, der traditionellen japanischen Flöte in traditioneller Kleidung.
Foto © Ken@Okinawa, Ryuteki player by Ken@Okinawa in Kamakura, Kanagawa, CC BY-SA 2.0
Zu den typischen Perkussionsinstrumenten gehören die Taiko (太鼓), eine große Fasstrommel, die im Gagaku als kolotomie-Instrument größere Musikabschnitte betont. In ihrer Unterform Dadaiko (sehr große Trommel) akzentuiert sie beim Tanz (Bugaku) die Fußtritte der Tänzer. Die Kakko (羯鼓) ist eine kleine, doppelseitig bespannte Trommel, die seitlich aufgestellt und auf beiden Seiten gespielt wird. Der Shōko (鉦鼓) ist ein kleiner Gong aus Bronze, der in drei Größen gespielt wird. Die Schlägel bestehen meist aus Horn.
Die für Gagaku verwendeten Instrumente bestehen typischerweise aus hochwertigen Materialien wie Bambus, Holz und Seide und sind oft reich verziert. Ihre Herstellung erfordert großes handwerkliches Können. Die Bedeutung dieser Instrumente zeigt sich auch darin, dass 13 der damals 30 Instrumente, die 752 bei der Enthüllung des großen Buddha im Tōdai-ji (東大寺, „Großer Tempel des Ostens“) in Nara gespielt wurden, bis heute erhalten sind.
Neben ihrer ästhetischen und klanglichen Qualität besitzen die Instrumente aufgrund der Nähe zum Shintō teils auch eine rituelle oder spirituelle Bedeutung.
Die verschiedenen Formen von Gagaku
Gagaku ist ein Sammelbegriff für verschiedene Formen der klassischen höfischen Musik Japans. Abgesehen von der rituellen Kagura-Musik unterscheidet man zwischen Ensemblemusik, Gesangsformen und der musikalischen Untermalung von Tanz.
Die instrumentale Ensemblemusik des Gagaku wird als Kangen bezeichnet. Kangen wird ohne Tanz aufgeführt und besteht meist aus drei Instrumentengruppen (Saiten-, Blas- und Perkussionsinstrumente). Dabei stehen die Saiten- und Blasinstrumente im Vordergrund.
Die instrumentale Gagaku-Musik zur Begleitung von Tanzaufführungen wird Bugaku genannt. Sie umfasst in der Regel nur zwei Instrumentengruppen (Saiten- und Perkussionsinstrumente). Die dazugehörigen Tänze sind oft langsam und symbolisch, wobei Musik und Tanz eng aufeinander abgestimmt sind.
Gagaku umfasst drei Formen des von Instrumenten begleiteten Gesangs. Shōmyō (声明) bezeichnet buddhistische Gesänge, die in Tempeln, bei religiösen Zeremonien und als rituelle Praxis gesungen werden. Saibara sind von Musik begleitete Lieder und Poesie, die meist auf klassischer japanischer Literatur oder historischen Ereignissen beruhen und auf Japanisch gesungen werden. Rōei sind Gesänge, deren Texte auf Chinesisch verfasst sind. Sie basieren oft auf Gedichten. Die Musikbegleitung unterscheidet sich hier durch die spezifische Instrumentenzusammensetzung.
Die heute stark formalisierten Stücke der Gagaku-Musik folgen typischerweise einem Muster aus Netori (Vorspiel), Thema A, Thema B, Thema A und Tomede (Schluss). Das Tempo der Musik ist für westliche Hörer oft ungewöhnlich langsam. Ein weiteres wichtiges Strukturmerkmal ist das Jo-ha-kyū (序破急), eine Form der Modulation, die nicht nur in der Gagaku-Musik, sondern auch in anderen klassischen japanischen Künsten wie Nō und Kabuki vorherrscht. Jo (序) bezeichnet die langsame Einleitung, Ha (破) einen schnellen, komplexen Mittelteil und Kyū (急) einen rapiden, abrupten Schluss. Längere Stücke können einen zweiten Mittelteil haben, während kürzere Stücke oft auf die Einleitung verzichten.
Zwei besonders bekannte Stücke der Gagaku-Musik sind Etenraku (越天楽), das oft als Tanz aufgeführt wird und bei Hochzeiten in Japan beliebt ist, sowie Bairo, das sowohl instrumental als auch zur Tanzbegleitung aufgeführt wird. Die Taktart wechselt dabei – 6/4 bei der instrumentalen Darbietung und 5/4 bei der Tanzbegleitung.
Die Aufführungspraxis von Gagaku
Die Aufführungspraxis von Gagaku ist hochkomplex und in vielen Aspekten sehr detailliert. Dies liegt an der besonderen Stellung von Gagaku als Hofmusik und den damit verbundenen rituellen Aspekten. Traditionell wurde Gagaku am Kaiserhof, zu staatlichen Zeremonien sowie bei rituellen Anlässen in Shinto-Schreinen und buddhistischen Tempeln gespielt. Heute gibt es jedoch auch öffentliche Auftritte bei Festivals oder in Form von Gagaku-Konzerten.
Die Musiker sitzen bei instrumentalen Stücken nach Instrumentengruppen geordnet auf der Bühne. Bei einer Bugaku-Tanzvorführung nehmen sie ihre Position neben oder hinter der Bühne ein, auf der die Tänzer auftreten. Die genaue Sitzanordnung drückt eine Hierarchie sowie die rituelle Bedeutung der Instrumente aus.
Die Kleidung der Musiker während der Aufführung orientiert sich an der Hofkleidung der Heian-Zeit. Es werden prachtvolle Roben aus Seidenstoffen getragen, oft verziert mit kaiserlichen Symbolen. Auch die Farben der Gewänder sind strikt vorgegeben und richten sich nach dem Anlass.
Die Rolle von Gagaku ist neben der Funktion als Hofmusik auch stark rituell und symbolisch. Besonders bei Ritualen des Shintō und Buddhismus steht Gagaku im Vordergrund, da es die Verbindung des Kaisers mit den Göttern und dem Volk symbolisiert.

-
Gagaku-Instrumente, vorgestellt in einer Zeitschrift aus Wien im Jahr 1883.
Foto © Die Gartenlaube (1883) b 357, als gemeinfrei gekennzeichnet, Details auf Wikimedia Commons
Die Bedeutung von Gagaku in der japanischen Kultur
Die Bedeutung von Gagaku in der japanischen Kultur liegt neben dem kulturellen Erbe vor allem in seiner engen Verbindung zum japanischen Kaiserhaus. Es symbolisiert die Verbindung des Kaisers zu den Kami (Shintō-Gottheiten), von denen die japanische Kaiserfamilie mythisch abstammt. Dadurch wird Gagaku zu einem Ausdruck der Macht und Autorität des Kaisers als direkter Abkömmling der Götter.
Zusätzlich ist Gagaku, wie das Amt des Kaisers selbst, ein wichtiges Element der nationalen Identität Japans. Es trägt zur Einheit des Landes bei, die symbolisch durch das Kaiserhaus dargestellt wird.
Darüber hinaus hat Gagaku andere japanische Musikformen wie die des Nō-Theaters und des Kabuki beeinflusst. Auch heute noch dient es als Referenz und hat einen bedeutenden Einfluss auf die moderne japanische Musik.
Gagaku in der modernen Zeit
Auch wenn Gagaku oft als Musik einer vergangenen Zeit wirkt, wird diese traditionelle Kunstform aktiv vom Staat gefördert. Das Erlernen von Gagaku erfolgt in speziellen Schulen, an denen angehende Musiker ausgebildet werden. Diese sind nicht mehr auf die alten Musikersippen oder Gilden aus Nara, Kyoto und Osaka beschränkt, die jedoch weiterhin eine wichtige Rolle für die Erhaltung der Musik spielen.
Die moderne Technik erleichtert es, Gagaku und sein noch vorhandenes Repertoire in Form von Aufzeichnungen zu bewahren und einem breiten, auch internationalen Publikum zugänglich zu machen. Öffentliche Aufführungen in Japan und weltweit tragen ebenfalls dazu bei, das Interesse an Gagaku wachzuhalten.
Die internationale Bedeutung zeigt sich auch in der Aufnahme von Gagaku in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit durch die UNESCO.
Darüber hinaus hat Gagaku einen Einfluss auf zeitgenössische Musik und Filmmusik. Auch moderne Kunstformen wie Tanz oder Performance-Kunst integrieren manchmal Elemente der Gagaku-Musik.
Wo kann man Gagaku heute erleben?
Gagaku wird heute regelmäßig öffentlich aufgeführt. International geschieht dies vor allem im Rahmen von Festivals oder kulturellen Veranstaltungen mit Bezug zur japanischen Musik. In Japan selbst finden regelmäßig Aufführungen an verschiedenen Orten und zu unterschiedlichen Anlässen statt.
Im religiösen und spirituellen Bereich gibt es regelmäßig Gagaku-Aufführungen in bedeutenden Shintō-Schreinen wie dem Meiji-Schrein in Tokio oder dem Ise-Schrein in Mie. Auch am Kaiserhof im Kaiserpalast in Tokio werden zu bestimmten Anlässen öffentliche Gagaku-Darbietungen angeboten.
Die wichtigsten Events und Festivals sind das Gagaku-Festival im Kasuga-Taisha-Schrein in Nara sowie das Gagaku-Konzert im Nationaltheater in Tokio, das regelmäßig auch andere traditionelle japanische Kunstformen wie Kabuki, Nō oder Bunraku präsentiert.
Touristen haben zudem die Möglichkeit, an Gagaku-Workshops teilzunehmen. Museen und andere Institutionen bieten Führungen zu diesem musikalischen Themenkomplex an, die einen tieferen Einblick in die Tradition dieser Kunstform ermöglichen. Einige Museen präsentieren zudem dauerhafte Ausstellungen, bei denen Gagaku-Aufnahmen zu hören sind.
Das könnte Sie auch interessieren:
Japans Kaiserhaus: Mythen, Geheimnisse und interessante Fakten um die japanische Monarchie
Bunraku: Das japanische Puppentheater einfach erklärt
Nihon Buyō – die traditionelle japanische Tanzkunst Buto
Titelfoto © anonym, gemeinfrei, Wikimedia Commons
Passende Artikel
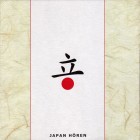
CD Japan Hören
Die Erste Hörbuch-CD zum Thema Japan von Corinna Hesse und Antje Hinz. Das Japan-Hörbuch nimmt den Hörer mit auf eine eindrucksvolle Reise durch die Kulturgeschichte Japans und durch faszinierende Klangwelten. Information, Erzählung und originale Musik aus Japan greifen atmosphärisch dicht ineinander. Anders als bei Reise- oder Kulturführern in Printform finden die Hörer mit Text, Klängen und Musik...
15,90 € *
Inhalt: 1

Drehtrommel
Kleine rote Drehtrommel mit japanischem Kanji. Durch einfaches in der Hand oder zwischen den Händen Hin- und Herdrehen schlagen die Kugeln auf das Trommelfell. Das Kanji wird "matsu" gelesen und bedeutet Fest/Festival.
6,50 € *
Inhalt: 1 Stück

Sonnenschirm Pflaumenblüten
Dieser japanische Sonnenschirm , auch Geisha-Schirm , ist nach traditioneller Art mit Papier bespannt, Stab und Rippen sind aus Bambus gefertigt. Der „ Wagasa “ ist mit dem traditionellem, japanischen „Ume no hana“ Motiv bedruckt. Die Bespannung des Schirms ist nicht beschichtet und daher nicht wasserfest . Bitte verwenden Sie Ihren Wagasa daher nur bei trockenem Wetter. Produkteigenschaften...
35,00 € *
Inhalt: 1
Kommentar schreiben